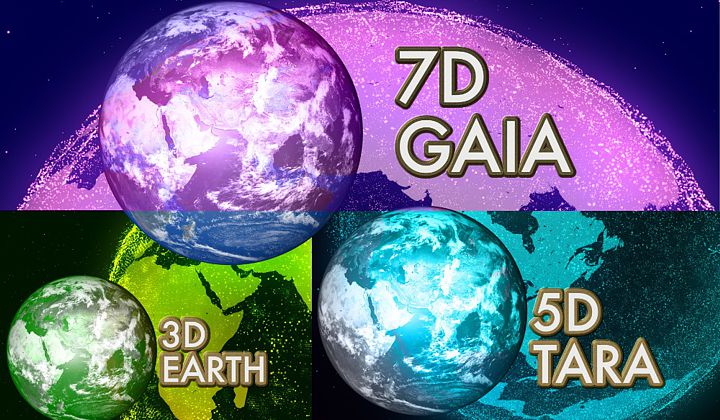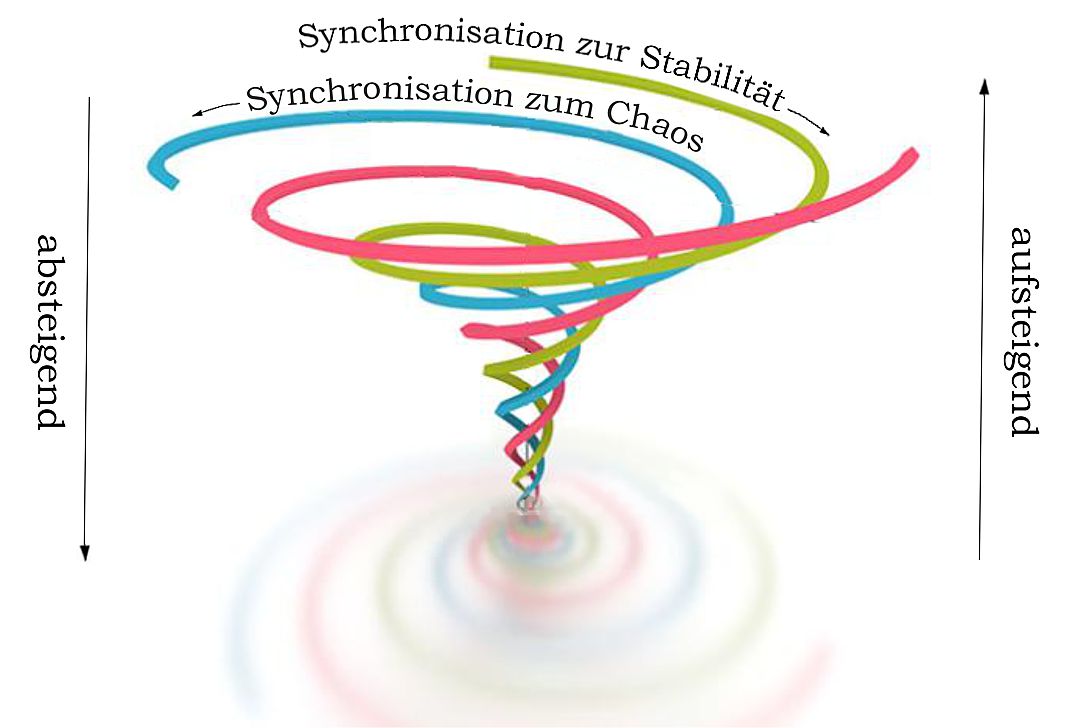Geschichten, die berühren und inspirieren
Auf dieser Seite möchte ich schöne Geschichten sammeln! Wenn ihr vielleicht auch eine, schöne Geschichte wisst und dazu beitragen möchtet, würde ich mich sehr freuen. Einfach schicken an info@lifeandlove.de!
Der Baum
Eine neue Stadt
Das Märchen von der traurigen Traurigkeit
Die Geschichte von den zwei Fröschen
Wahre Nähe
Es war einmal ein Herz…
Traumfänger
Genieße das Leben
Die kleine Seele
Eine Versammlung von Engeln
Ein kleiner Junge will Gott treffen
Mothvana-Land
Die Meditation im Boot
Seesterne
Zwillinge in der Gebährmutter
Die Löwen und die Schafe
Sternengeburt
Der Geizige
Die Frau aus dem Regenbogen
Drei Wünsche
Das schöne Herz
Der Dieb und der Zen-Meister
Der Einbrecher und der Meister
Chinesische Legende von einer Frau, deren Sohn starb
Lebensbürde
Das Wunder der Perle
Das verrückte Königreich
Der Mann, der nicht an die Liebe glaubte
Ein Brief an Gott
Der Esel im Brunnen
Himmel und Hölle
Der übereifrige Dschinn
Ein Platz am Fenster
Die weiße Rose
Der Sieg über den Teufel
Der Weise und der Diamant
Die Schuld und ihr Zorn
Der wahre Wert
Der König und der Tod
Die erstaunlichen Meister
Der König mit den vier Frauen
Der vertrauensvolle Berater

Der Baum
Es war einmal ein Gärtner. Eines Tages nahm er seine Frau bei der Hand und sagte.: „Komm Frau, wir wollen einen Baum pflanzen.“ Die Frau antwortete: „Wenn du meinst, mein lieber Mann, dann wollen wir einen Baum pflanzen.“ Sie gingen in den Garten und pflanzten einen Baum. Es dauerte nicht lange, da konnte man das erste Grün zart aus der Erde sprießen sehen.
Der Baum, der eigentlich noch kein richtiger Baum war, erblickte zum ersten Mal die Sonne. Er fühlte die Wärme ihrer Strahlen auf seinen Blättchen und streckte sich ihnen hoch entgegen. Er begrüßte sie auf seine Weise, ließ sich glücklich bescheinen und fand es wunderschön, auf der Welt zu sein und zu wachsen. „Schau“, sagte der Gärtner zu seiner Frau, „ist er nicht niedlich, unser Baum?“ Und seine Frau antwortete: „Ja, lieber Mann, wie du schon sagst: „Ein schöner Baum!“
Der Baum begann größer und höher zu wachsen und reckte sich immer weiter der Sonne entgegen. Er fühlte den Wird und spürte den Regen, genoss die warme und feste Erde um seine Wurzeln und war glücklich. Und jedes Mal, wenn der Gärtner und seine Frau nach ihm sahen, ihn mit Wasser tränkten und ihn einen schönen Baum nannten, fühlte er sich wohl.
Denn da war jemand, der ihn mochte, ihn hegte, pflegte und beschützte. Er wurde liebgehabt und war nicht allein ein auf der Welt. So wuchs er zufrieden vor sich hin und wollte nichts weiter als leben und wachsen, Wind und Regen spüren, Erde und Sonne fühlen, liebgehabt werden und andere liebhaben.
Eines Tages merkte der Baum, dass es besonders schön war, ein wenig nach links zu wachsen, denn von dort schien die Sonne mehr auf seine Blätter. Also wuchs er jetzt ein wenig noch links. „Schau“, sagte der Gärtner zu seiner Frau, „unser Baum wächst schief. Seit wann dürfen Bäume denn schief wachsen, und dazu noch in unserem Garten? Ausgerechnet unser Baum! Gott hat die Bäume nicht erschaffen, damit sie schief wachsen, nicht wahr, Frau?“
Seine Frau gab ihm natürlich recht. „Du bist eine kluge und gottesfürchtige Frau“, meinte daraufhin der Gärtner. „HoI also unsere Schere, denn wir wollen unseren Baum gerade schneiden.“
Der Baum weinte. Die Menschen, die ihn bisher so lieb gepflegt hatten, denen er vertraute, schnitten ihm die Äste ab, die der Sonne am nächsten waren. Er konnte nicht sprechen und deshalb nicht fragen. Er konnte nicht begreifen. Aber sie sagten ja, dass sie ihn liebhätten und es gut mit ihm meinten. Und sie sagten, dass ein richtiger Baum gerade wachsen müsse. Und Gott es nicht gern sähe, wenn er schief wachse. Also musste es wohl stimmen. Er wuchs nicht mehr der Sonne entgegen. „Ist er nicht brav, unser Baum?“ fragte der Gärtner seine Frau „sicher lieber Mann“, antwortete sie, „du hast wie immer recht. Unser Baum ist ein braver Baum.“
Der Baum begann zu verstehen. Wenn er machte, was ihm Spaß und Freude bereitete, dann war er anscheinend ein böser Baum. Er war nur lieb und brav, wenn er tat, was der Gärtner und seine Frau von ihm erwarteten. Also wuchs er jetzt strebsam in die Höhe und gab darauf acht, nicht mehr schief zu wachsen. „Sieh dir das an“, sagte der Gärtner eines Tages zu seiner Frau, „unser Baum wächst unverschämt schnell in die Höhe. Gehört sich das für einen rechten Baum?“ Seine Frau antwortete: „Aber nein, lieber Mann, das gehört sich natürlich nicht. Gott will, dass Bäume langsam und in Ruhe wachsen. Und auch unser Nachbar meint, dass Bäume bescheiden sein müssten, ihrer wachse auch schön langsam.“ Der Gärtner lobte seine Frau und sagte, dass sie etwas von Bäumen verstehe. Und dann schickte er sie die Schere holen, um dem Baum die Äste zu stutzen.
Sehr lange weinte der Baum in dieser Nacht. Warum schnitt man ihm einfach die Äste ab, die dem Gärtner und seiner Frau nicht gefielen? Und wer war dieser Gott, der angeblich gegen alles war, was Spaß machte? „Schau her, Frau“, sagte der Gärtner, „wir können stolz sein auf unseren Baum.“ Und seine Frau gab ihm wie immer recht. Der Baum wurde trotzig. Nun gut, wenn nicht in die Höhe, dann eben in die Breite. Sie würden ja schon sehen, wohin sie damit kommen. Schließlich wollte er nur wachsen, Sonne, Wind und Erde fühlen, Freude haben und Freude bereiten. In seinem Innern spürte er ganz genau, dass es richtig war, zu wachsen. Also wuchs er jetzt in die Breite.
„Das ist doch nicht zu fassen“. Der Gärtner holte empört die Schere und sagte zu seiner Frau: „Stell dir vor, unser Baum wächst einfach in die Breite. Das könnte ihm so passen. Das scheint ihm ja geradezu Spaß zu machen. So etwas können wir auf keinen Fall dulden!“ Und seine Frau pflichtete ihm bei: „Das können wir nicht zulassen. Dann müssen wir ihn eben wieder zurechtstutzen.“
Der Baum konnte nicht mehr weinen, er hatte keine Tränen mehr. Er hörte auf zu wachsen. Ihm machte das Leben keine rechte Freude mehr. Immerhin, er schien nun dem Gärtner und seiner Frau zu gefallen. Wenn auch alles keine rechte Freude mehr bereitete, so wurde er wenigstens liebgehabt. So dachte der Baum.
Viele Jahre später kam ein kleines Mädchen mit seinem Vater am Baum vorbei. Er war inzwischen erwachsen geworden, der Gärtner und seine Frau waren stolz auf ihn. Er war ein rechter und anständiger Baum geworden.
Das kleine Mädchen blieb vor ihm stehen. „Papa, findest du nicht auch, dass der Baum hier ein bisschen traurig aussieht?“ fragte es. „Ich weiß nicht“, sagte der Vater. „Als ich so klein war wie du, konnte ich auch sehen, ob ein Baum fröhlich oder traurig ist. Aber heute sehe ich das nicht mehr.“ „Der Baum sieht wirklich traurig aus.“ Das kleine Mädchen sah den Baum mitfühlend an. „Den hat bestimmt niemand richtig lieb. Schau mal, wie ordentlich der gewachsen ist. Ich glaube, der wollte mal ganz anders wachsen, durfte aber nicht. Und deshalb ist er jetzt traurig.“ „Vielleicht“, antwortete der Vater versonnen.
„Aber wer kann schon wachsen, wie er will?“ „Warum denn nicht?“ fragte das Mädchen. „Wenn jemand den Baum wirklich liebhat, kann er ihn auch wachsen lassen, wie er selber will. Oder nicht? Er tut doch niemandem etwas zuleide.“ Erstaunt und schließlich erschrocken blickte der Vater sein Kind an. Dann sagte er: „Weißt du, keiner darf so wachsen, wie er will, weil sonst die anderen merken würden, dass auch sie nicht so gewachsen sind, wie sie eigentlich mal wollten.“ „Das verstehe ich nicht, Papa!“ „Sicher, Kind, das kannst du noch nicht verstehen. Auch du bist vielleicht nicht immer so gewachsen, wie du gerne wolltest. Auch du durftest nicht.“ „Aber warum denn nicht, Papa? Du hast mich doch lieb und Mama hat mich auch lieb, nicht wahr?“ Der Vater sah sie eine Weile nachdenklich an. „Ja“ sagte er dann, „sicher haben wir dich lieb.“
Sie gingen langsam weiter und das kleine Mädchen dachte noch lange über dieses Gespräch und den traurigen Baum nach. Der Baum hatte den beiden aufmerksam zugehört, und auch er dachte lange nach.
Er blickte ihnen noch hinterher, als er sie eigentlich schon lange nicht mehr sehen konnte. Dann begriff der Baum. Und er begann hemmungslos zu weinen.
In dieser Nacht war das kleine Mädchen sehr unruhig. Immer wieder dachte es an den traurigen Baum und schlief schließlich erst ein, als bereits der Morgen zu dämmern begann. Natürlich verschlief das Mädchen an diesem Morgen. Als es endlich aufgestanden war, wirkte sein Gesicht blass und stumpf. „Hast du etwas Schlimmes geträumt?“, fragte der Vater. Das Mädchen schwieg, schüttelte dann den Kopf. Auch die Mutter war besorgt: „Was ist mit dir?“
Und da brach schließlich doch all der Kummer aus dem Mädchen. Von Tränen überströmt stammelte es: „Der Baum. Er ist so schrecklich traurig. Darüber bin ich so traurig. Ich kann das alles einfach nicht verstehen.“ Der Vater nahm die Kleine behutsam in seine Arme, ließ sie in Ruhe ausweinen und streichelte sie nur liebevoll. Dabei wurde ihr Schluchzen nach und nach leiser und die Traurigkeit verlor sich allmählich. Plötzlich leuchteten die Augen des Mädchens auf, und ohne dass die Eltern etwas begriffen, war es aus dem Haus gerannt. Wenn ich traurig bin und es vergeht, sobald mich jemand streichelt und in die Arme nimmt, geht es dem Baum vielleicht ähnlich – so dachte das Mädchen.
Und als es ein wenig atemlos vor dem Baum stand, wusste es auf einmal, was zu tun war. Scheu blickte die Kleine um sich. Als sie niemanden in der Nähe entdeckte, strich sie zärtlich mit den Händen über die Rinde des Baumes. Leise flüsterte sie dabei: „Ich mag dich, Baum. Ich halte zu dir. Gib nicht auf, mein Baum!“ Nach einer Weile rannte sie wieder los, weil sie ja zur Schule musste. Es machte ihr nichts aus, dass sie zu spät kam, denn sie hatte ein Geheimnis und eine Hoffnung.
Der Baum hatte zuerst gar nicht bemerkt, dass ihn jemand berührte.
Er konnte nicht glauben, dass das Streicheln und die Worte ihm galten – und auf einmal war er ganz verblüfft, und es wurde sehr still in ihm.
Als das Mädchen wieder fort war, wusste er zuerst nicht, ob er lachen oder weinen sollte.
Dann schüttelte er seine Krone leicht im Wind, vielleicht ein bisschen zu heftig, und sagte zu sich, dass er wohl geträumt haben müsse. Oder vielleicht doch nicht? In einem kleinen Winkel seines Baumherzens hoffte er, dass es kein Traum gewesen war.
Auf dem Heimweg von der Schule war das Mädchen nicht allein. Trotzdem ging es dicht an dem Baum vorbei, streichelte ihn im Vorübergehen und sagte leise: „Ich mag dich und ich komm bald wieder.“ Da begann der Baum zu glauben, dass er nicht träumte, und ein ganz neues, etwas seltsames Gefühl regte sich in einem kleinen Ast.
Die Mutter wunderte sich, dass ihre Tochter auf einmal so gerne einkaufen ging. Auf alle Fragen der Eltern lächelte die Kleine nur und behielt ihr Geheimnis für sich. Immer wieder sprach das Mädchen nun mit dem Baum, umarmte ihn manchmal, streichelte ihn oft. Er verhielt sich still, rührte sich nicht. Aber in seinem Innern begann sich etwas immer stärker zu regen.
Wer ihn genau betrachtete, konnte sehen, dass seine Rinde ganz langsam eine freundlichere Farbe bekam. Das Mädchen jedenfalls bemerkte es und freute sich sehr.
Der Gärtner und seine Frau, die den Baum ja vor vielen Jahren gepflanzt hatten, lebten regelmäßig und ordentlich, aber auch freudlos und stumpf vor sich hin. Sie wurden älter, zogen sich zurück und waren oft einsam.
Den Baum hatten sie so nach und nach vergessen, ebenso wie sie vergessen hatten, was Lachen und Freude ist – und Leben.
Eines Tages bemerkten sie, dass manchmal ein kleines Mädchen mit dem Baum zu reden schien. Zuerst hielten sie es einfach für eine Kinderei, aber mit der Zeit wurden sie doch etwas neugierig. Schließlich nahmen sie sich vor, bei Gelegenheit einfach zu fragen, was das denn soll.
Und so geschah es dann auch. Das Mädchen erschrak, wusste nicht so recht wie es sich verhalten sollte. Einfach davonlaufen wollte es nicht, aber erzählen, was wirklich war – das traute es sich nicht. Endlich gab die Kleine sich einen Ruck, dachte: „Warum eigentlich nicht?“ und erzählte die Wahrheit. Der Gärtner und seine Frau mussten ein wenig lachen, waren aber auf eine seltsame Weise unsicher, ohne zu wissen, warum. Ganz schnell gingen sie wieder ins Haus und versicherten sich gegenseitig, dass das kleine Mädchen wohl ein wenig verrückt sein müsse.
Aber die Geschichte ließ sie nicht mehr los. Ein paar Tage später waren sie wie zufällig in der Nähe des Baumes, als das Mädchen wiederkam.
Dieses Mal fragte es die Gärtnersleute, warum sie denn den Baum so zu rechtgestutzt haben. Zuerst waren sie empört, konnten aber nicht leugnen, dass der Baum in den letzten Wochen ein freundlicheres Aussehen bekommen hatte.
Sie wurden sehr nachdenklich. Die Frau des Gärtners fragte schließlich: „Meinst du, dass es falsch war, was wir getan haben?“ „Ich weiß nur“, antwortete das Mädchen, „dass der Baum traurig ist. Und ich finde, dass das nicht sein muss. Oder wollt ihr einen traurigen Baum?“ „Nein“ rief der Gärtner, „natürlich nicht. Doch was bisher gut und recht war, ist ja wohl auch heute noch richtig, auch für diesen Baum.“ Und die Gärtnersfrau fügte hinzu. „Wir haben es doch nur gut gemeint.“
„Ja das glaube ich“, sagte das Mädchen, „ihr habt es sicher gut gemeint und dabei den Baum sehr traurig gemacht. Schaut ihn doch einmal genau an!“ Und dann ließ sie die beiden alten Leute allein und ging ruhig davon mit dem sicheren Gefühl, dass nicht nur der Baum Liebe brauchen würde.
Der Gärtner und seine Frau dachten noch sehr lange über dieses seltsame Mädchen und das Gespräch nach. Immer wieder blickten sie verstohlen zu dem Baum, standen oft vor ihm, um ihn genau zu betrachten. Und eines Tages sahen sie auch, dass der Baum zu oft beschnitten worden war. Sie hatten zwar nicht den Mut, ihn auch zu streicheln und mit ihm zu reden, aber sie beschlossen, ihn wachsen zu lassen, wie er wollte.
Das Mädchen und die beiden alten Leute sprachen oft miteinander – über dies oder das und manchmal über den Baum. Gemeinsam erlebten sie, wie er ganz behutsam, zuerst ängstlich und zaghaft, dann ein wenig übermütig und schließlich kraftvoll zu wachsen begann.
Voller Lebensfreude wuchs er schief nach unten, als wolle er zuerst einmal seine Glieder räkeln und strecken. Dann wuchs er in die Breite, als wolle er die ganze Welt in seine Arme schließen, und in die Höhe, um allen zu zeigen, wie glücklich er sich fühlt. Auch wenn der Gärtner und seine Frau es sich selbst nicht trauten, so sahen sie doch mit stiller Freude, dass das Mädchen den Baum für alles lobte, was sich an ihm entfalten und wachsen wollte.
Voll Freude beobachtete das Mädchen, dass es dem Gärtner und seiner Frau beinahe so ähnlich erging wie dem Baum. Sie wirkten lebendiger und jünger, fanden das Lachen und die Freude wieder und stellten eines Tages fest, dass sie wohl manches im Leben falsch gemacht hatten.
Auch wenn das jetzt nicht mehr zu ändern wäre, so wollten sie wenigstens den Rest ihres Lebens anders gestalten. Sie sagten auch, dass sie Gott wohl ein wenig falsch verstanden hätten, denn Gott sei schließlich Leben, Liebe und Freude und kein Gefängnis. So blühten gemeinsam mit dem Baum zwei alte Menschen zu neuem Leben auf.
Es gab keinen Garten weit und breit, in welchem ein solch schief und wild und fröhlich gewachsener Baum stand. Oft wurde er jetzt von Vorübergehenden bewundert, was der Gärtner, seine Frau und das Mädchen mit stillem, vergnügtem Lächeln beobachteten. Am meisten freute sie, dass der Baum all denen Mut zum Leben machte, die ihn wahrnahmen und bewunderten.
Diesen Menschen blickte der Baum noch lange nach – oft bis er sie gar nicht mehr sehen konnte. Und manchmal begann er dann, so dass es sogar einige Menschen spüren konnten, tief in seinem Herzen glücklich zu sein.
– Aus „Die Farben der Wirklichkeit“, Lucy Körner Verlag, Fellbach,
Heinz Körner, Bruno Streibel
Eine neue Stadt

Nach einer langen Wanderung kommt ein Mann an das Stadttor einer neuen Stadt. Und er fragt den Torwächter, der am Eingang steht: „Sag mir, wie sind die Menschen in dieser Stadt?!“
Und der Torwächter fragte zurück: „Wie waren sie denn dort, wo ihr herkommt?“
– „Oh, sie waren sehr freundlich, gütig, sehr herzlich und angenehm.“
– „Genau so werden sie auch hier sein!“ antwortete der Torwächter.
Ein paar Stunden später kam ein anderer Mann an das Tor. Und auch dieser fragte den Torwächter: „Wie sind die Menschen in dieser Stadt?“
Und wieder fragte der Torwächter: „Wie waren sie denn dort, wo ihr herkommt?“
– „Oh, sie waren fies, gemein, korrupt, sehr schlechte Menschen!“
Und der Torwächter antwortete: „Ich fürchte, so werden sie hier auch sein…“
Das Märchen von der traurigen Traurigkeit
Es war eine kleine Frau, die den staubigen Feldweg entlangkam. Sie war wohl schon recht alt, doch ihr Gang war leicht, und ihr Lächeln hatte den frischen Glanz eines unbekümmerten Mädchens. Bei einer zusammengekauerten Gestalt blieb sie stehen und sah hinunter. Sie konnte nicht viel erkennen. Das Wesen, dass da im Staube des Weges saß, schien fast körperlos. Es erinnerte an eine graue Flanelldecke mit menschlichen Konturen.
Die kleine Frau bückte sich ein wenig und fragte: ”Wer bist Du?” Zwei fast leblose Augen blickten müde auf. ”Ich? Ich bin die Traurigkeit,” flüsterte die Stimme stockend und so leise, dass sie kaum zu hören war. ”Ach, die Traurigkeit!” rief die kleine Frau erfreut aus, als würde sie eine alte Bekannte begrüßen. ”Du kennst mich?” fragte die Traurigkeit misstrauisch. ”Natürlich kenne ich dich! Immer wieder einmal hast du mich ein Stück des Weges begleitet.” ”Ja, aber…,” argwöhnte die Traurigkeit, ”warum flüchtest Du dann nicht vor mir? Hast du denn keine Angst?” „Warum sollte ich vor dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch selber nur zu gut, dass du den Flüchtigen einholst. Aber, was ich dich fragen will: Warum siehst du so mutlos aus?” „Ich… ich bin traurig”, antwortete die graue Gestalt mit brüchiger Stimme.
Die kleine, alte Frau setzte sich zu ihr. ”Traurig bist du also”, sagte sie und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. ”Erzähl mir doch, was dich bedrückt.” Die Traurigkeit seufzte tief. Sollte ihr diesmal wirklich jemand zuhören wollen? Wie oft hatte sie sich das schon gewünscht. ”Ach weißt du”, begann sie zögernd und äußerst verwundert, ”es ist so, dass mich einfach niemand mag. Es ist nun mal meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und für eine gewisse Zeit unter ihnen zu verweilen. Aber wenn ich zu ihnen komm, schrecken sie zurück. Sie fürchten sich vor mir und meiden mich wie die Pest. Die Traurigkeit schluckte schwer. ”Sie haben Sätze erfunden, mit denen sie mich bannen wollen.
Sie sagen pappalapapp, das Leben ist heiter. Und ihr falsches Lachen führt zu Magenkrämpfen und Atemnot. Sie sagen: ”gelobt sei was hart macht” und dann bekommen sie Herzschmerzen. Sie sagen: ”man muss sich zusammenreißen”. Und sie spüren das Reißen in den Schultern und im Rücken. Sie sagen: ”nur Schwächlinge weinen”. Und die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder aber, sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht fühlen müssen.”
”Oh ja” bestätigte die alte Frau, ”solche Menschen sind mir schon oft begegnet.” Die Traurigkeit sank noch ein wenig mehr in sich zusammen. ”Und dabei will ich den Menschen doch nur helfen. Wenn ich ganz nah bei ihnen bin, können sie sich selbst begegnen. Ich helfe ihnen ein Nest zu bauen, um Ihre Wunden zu pflegen. Wer Traurig ist hat eine besonders dünne Haut. Manches Leid bricht wieder auf, wie eine schlecht verheilte Wunde, und das tut sehr weh. Aber nur wer die Trauer zulässt und all die ungeweinten Tränen weint, kann seine Wunden wirklich heilen. Doch die Menschen wollen gar nicht, dass ich ihnen helfe. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über ihre Narben. Oder sie legen sich einen dicken Panzer an Bitterkeit zu.”
Die Traurigkeit schwieg. Ihr weinen war erst schwach, dann stärker und schließlich ganz verzweifelt. Die kleine, alte Frau nahm die zusammengesunkene Gestalt tröstend in ihre Arme. Wie weich und wie sanft sie sich anfühlt, dachte sie und streichelte zärtlich das zitternde Bündel. ”Weine nur, Traurigkeit”, flüsterte sie liebevoll, ”ruh Dich aus, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Du sollst von nun an nicht mehr alleine wandern. Ich werde Dich begleiten, damit die Mutlosigkeit nicht noch mehr an Macht gewinnt.” Die Traurigkeit hörte auf zu weinen. Sie richtete sich auf und betrachtete erstaunt ihre neue Gefährtin: ”Aber… aber – wer bist du eigentlich?” “Ich?” sagte die kleine Frau schmunzelnd und dann lächelte sie wieder so unbekümmert wie ein kleines Mädchen: ”ich bin die Hoffnung”.
Die Geschichte von den zwei Fröschen


Zwei Frösche hatten sich eines Nachts auf den Weg gemacht. Sie wollten ihre nähere oder entfernte Umgebung erkunden, um neue und interessante Dinge zu lernen. Sie genossen die kühle Nachtluft an ihren glatten Körpern. Wenn sie hüpften, hörte man das Platschen ihrer Füße. Der Mond beleuchtete ihren schmalen Pfad. Unerwartet befanden sich die beiden Frösche vor einer Tür, die einladend offenstand. Neugierig hüpften sie in einen kühlen Raum, auf dessen gekacheltem Boden mehrere Tonkrüge standen.
Ohne lange nachzudenken, sprang ein Frosch, nennen wir ihn Pitsch, auf einen der Krüge. Viel zu spät bemerkte er, dass der Krug keinen Deckel hatte, und er landete in einer weißen sahnigen Flüssigkeit. Patsch, der andere Frosch, hörte das Platschen, und da Frösche ein gutes Herz haben, sprang er sofort nach, um zu helfen. Manchmal ist es so, das Gefühl ist stärker als der Verstand. Bekanntlich können Frösche gut schwimmen, obwohl sie nicht wissen, dass das eine besondere Fähigkeit ist. Aber so ist es mit allen Lebewesen. Sie haben besondere Fähigkeiten, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Zuerst machte ihnen das Schwimmen Spaß. Sie schleckten von der süßen Sahne und blickten nach oben, wo das Mondlicht zum Träumen verführte. Bald aber wurden sie müde. »Ich kann nicht mehr«, keuchte Pitsch.
»Hier kommen wir nie heraus. Es hat keinen Sinn.« Patsch schwamm an die Seite von Pitsch. »Du hast recht, es sieht schwierig aus. Die Wände sind hoch und glatt. Aber denk mal, wie schön das Leben in unserem Froschteich ist, wenn wir alle zusammen sind, wenn wir gemeinsam singen und uns freuen, dass wir leben.« Pitsch schöpfte Hoffnung. »Ich will auch leben«, sagte er. »Wie sollen wir aber rauskommen? Ich kann denken, soviel ich will, ich sehe keine Lösung.« »Wenn es darauf ankommt«, überlegte Patsch laut, »findet man häufig intuitiv die richtige Lösung. Ich hatte mal einen Traum. Vor Millionen von Jahren waren unsere Vorfahren noch größer als wir, und sie konnten noch nicht so gut denken. Aber sie haben trotzdem überlebt, auch wenn es damals sehr gefährlich war und nicht sehr angenehm auf der Welt. So ungefähr wie jetzt bei uns im Krug.
Und weißt du, was unser Urahn mir im Traum gesagt hat? Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Tief in uns wissen wir die Lösung. Es findet sich immer ein Weg, wenn man nicht aufgibt. Kommt Zeit, kommt Rat!« Die Frösche strampelten weiter. Als nach einiger Zeit Patsch keine Kraft mehr hatte, redete Pitsch ihm zu. »Wozu haben wir uns so lange abgemüht, wenn du jetzt aufhören willst? Weiß du noch, wie es damals war, als der Storch uns auflauerte und du ihn immer wieder geschickt und mutig von der Familie weggelockt hast?« So sprachen sie sich gegenseitig Mut zu, und die Erinnerung an vergangene Zeiten, als es ihnen gelang, auch in ausweglos erscheinenden Lagen zu überleben, gab ihnen neue Energie.
Endlich graute der Morgen. Und als die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster lugten, spürten die beiden Frösche plötzlich etwas Festes unter ihren Füßen. Sie saßen auf einem großen Klumpen Butter, den sie selbst, ohne sich dessen bewusst zu sein, mit ihren Füßen geschaffen hatten. Sie waren glücklich, dass sie lebten, und dankbar für die Erfahrung dieser Nacht, die ihr zukünftiges Leben prägen würde.
Wahre Nähe
»In Ostafrika gibt es einen Stamm, in dem wahre Nähe bereits vor der Geburt gefördert wird. In diesem Stamm gilt als Tag der Geburt eines Kindes nicht der Tag der tatsächlichen Geburt und auch nicht der Tag der Empfängnis wie in anderen Dorfkulturen. Für diesen Stamm ist der Tag der Geburt dann gekommen, wenn die zukünftige Mutter zum ersten Mal an ihr Kind denkt. Wenn sie sich ihrer Absicht, mit einem bestimmten Vater ein Kind zu empfangen, bewusst ist, setzt sie sich allein unter einen Baum. Dort lauscht sie in sich hinein, bis sie das Lied des Kindes hören kann, das sie zu empfangen hofft. Wenn sie es gehört hat, kehrt sie in ihr Dorf zurück und gibt das Lied an den zukünftigen Vater weiter, damit sie es gemeinsam singen können, während sie sich lieben, wobei sie das Kind einladen, miteinzustimmen.
Nach der Empfängnis des Kindes, singt sie es dem Baby, das in ihrem Leib heranwächst, vor. Dann lehrt sie das Lied den alten Frauen und Hebammen im Dorf, so dass das Kind während des Geburtsvorgangs und im wunderbaren Augenblick der Geburt mit seinem Lied begrüßt wird. Nach der Geburt lernen alle Dorfbewohner das Lied des neuen Stammesmitglieds und singen es dem Kind vor, wenn es sich weh tut. Es wird zu Zeiten des Triumphs oder bei Ritualen und Initiationsriten gesungen. Das Lied wird Teil der Heiratszeremonie, wenn das Kind erwachsen ist, und am Ende seines Lebens versammeln sich die Angehörigen an seinem Sterbebett und singen sein Lied ein letztes Mal.«
Quelle: „Frag den Buddha und geh den Weg des Herzens“ von Jack Kornfeld
Es war einmal ein Herz…

Das schlug 100.000 Mal am Tag – nicht mehr und nicht weniger. Es schlug nun einmal so viel wie es nötig war. Das Herz war nicht von der gleichen feuerroten Farbe wie all die anderen Herzen, sondern besaß nur ein schwaches blassrosa. Das schlimme war, dass es mit der Zeit immer mehr an Farbe verlor. Der Lebenskampf hatte es geschwächt und obwohl es noch nicht sehr alt war, hatte es schon viele Falten.
Eines Tages war es auf die Idee gekommen einen Verschlag um sich zu bauen. So suchte es den härtesten Stein für die Wände, dass massivste Holz für das Dach und den stärksten Stahl für die Tür.
Nur so, dachte das Herz, konnte niemand mehr hinein zu ihm und es verletzen – niemand konnte es mehr zerreißen. Endlich war es sicher.
Nun saß das kleine Herz in seinem Verschlag, lugte hinaus durch die Fugen im Stein und hörte über sich das Knacken des Holzes. Es war ziemlich dunkel und kalt, dachte sich das Herz. Aber es schloss einfach die Augen und tat was es immer tat -schlagen. 100.000 Mal am Tag. Vor lauter Langeweile zählte das Herz jeden Schlag mit, bis es ihm überdrüssig wurde. So vergaß es manchmal einen Schlag zu tun.
Das Herz fragte sich, was es überhaupt noch für einen Sinn hatte zu schlagen.
Was das Herz vergessen hatte, war, dass es sich zwar in Sicherheit vor allem Bösen befand, es niemand mehr verletzen und enttäuschen konnte, dass aber auch niemand mehr hineinkommen würde, der mit ihm lachen täte, jemand der Purzelbäume mit ihm schlagen würde und es wärmte.
Nach einiger Zeit fing das Herz an darüber nachzudenken.
Es merkte, einen fatalen Fehler begangen zu haben. Mit aller Kraft versuchte es die Stahltür aufzudrücken, doch sie war zu schwer, als dass sie sich bewegen ließ.
So begann es gegen die Steinwände zu hämmern, doch außer das sich ein paar Brocken lösten, passierte nichts. Der Stein war zu gewaltig. Als es sich am Dach zu schaffen machte, zog es sich nur einen dicken Splitter zu.
Panikartig saß das kleine Herz in seinem selbstgebauten Gefängnis und schlug mindestens doppelt so schnell wie sonst. Wie konnte es nur den Schlüssel in all seiner Trauer vergessen? Das Herz verfluchte sich für sein elendes Selbstmitleid.
Wie gern würde es sich jetzt den Stürmen des Lebens hingeben, sich vor Angst zusammenkrampfen, vor Freude hüpfen, wenn es nur könnte.
Es schaute durch das Schlüsselloch hinaus in die Welt und sah die anderen Herzen. Einige waren blass so wie es selbst. Sie schlichen durchs Leben geduckt und allein. Andere wiederum sprangen in leuchtendem Rot – Hand in Hand über Stock und Stein, unerschrocken und gestärkt vom anderen.
Doch was das Herz dann sah, ließ es staunen und es konnte seine Tränen nicht verbergen. Da lagen Herzen im Staub mit Füßen getreten.
Sie waren weiß und regten sich kaum noch. Sie schlugen vielleicht noch 20 Mal am Tag.
Niemand kümmerte sich um sie, denn auch sie hatten einmal den Schlüssel ihres Gefängnisses so gut versteckt, dass niemand ihn fand.
Da fühlte das Herz zum 1. Mal, dass es ihm noch gar nicht so schlecht ging. Noch war es rosa und noch fühlte es etwas. Es musste nur diesen Schlüssel finden zu seiner Stahltür. So machte es sich auf die Suche und probierte alle Schlüssel, die es finden konnte. Es probierte sogar Schlüssel, von denen es von Anfang an wusste, dass sie nicht passen würden.
Nach einiger Zeit merkte das Herz, dass es wieder einen Fehler begangen hatte.
Es war zu unüberlegt, zu krampfhaft an die Sache gegangen. Es verstand, dass man das Glück nicht erzwingen kann.
Frei ist man nur, wenn man frei denken kann. Das Herz entspannte sich erst einmal und beschäftigte sich mit sich selbst. Es schaute in den Spiegel und begann sich so zu akzeptieren wie es war, blassrosa und faltig.
Es spürte eine wohlige Wärme in sich aufsteigen und eine innere Gewissheit, dass es auf seine Art und Weise wunderschön war.
So fing es an zu singen, erst ganz leise und schnurrend und nach und nach immer lauter und heller, bis es ein klares Zwitschern war, wie das eines Vogels am Himmel.
Durch den hellen Ton begann der Stein an einer Stelle nachzugeben.
Mit riesengroßen Augen starrte das Herz auf diese Stelle, wo ein goldenes Schimmern zu erkennen war.
Das Herz traute seinen Augen nicht. Da war der Schlüssel, den es damals mit in den Stein eingemauert hatte. Das hatte es durch all seinen Schmerz und Selbstmitleid vergessen und jetzt wo es den Schlüssel in der Hand hielt, fiel es ihm wieder ein, wie es ihm vor all den Jahren so sicher erschien, ihn nie wieder zu brauchen.
Langsam und voller Bedacht den Schlüssel nicht abzubrechen, steckte das Herz ihn ins Schloss.
Mit lautem Gequietsche schob sich die schwere Stahltür zur Seite. Das Herz machte einen Schritt nach draußen, schloss die Augen und atmete tief die frische Luft ein.
Es streckte die Arme aus, drehte und wendete sich, blickte nach oben und nach unten und hörte gespannt mal hierhin und mal dorthin.
Das Herz dachte wie schön das Leben doch sei, machte einige Hüpfer und begab sich auf den Weg um Freunde zu finden.
Den 1. den es traf war eine lustiger Geselle, der das Leben zum schießen komisch fand und über 1000 Freunde hatte.
Nachdem das Herz einige Zeit mit ihm verbrachte, mit ihm alle erdenklich lustigen Sachen anstellte, merkte das Herz, dass diesem „Freund“ einiges fehlte ; – der Tiefgang.
Was war das für ein Freund, mit dem es nur lachen aber nie weinen konnte?
Mit dem es nur durch „Dick“ aber nie durch „Dünn“ gehen würde.
So zog das Herz weiter, allein, aber reich einer neuen Erfahrung.
Bis es auf eine Gruppe anderer Herzen stieß. Es wurde direkt freundlich in ihre Mitte aufgenommen.
Es war ein ganz neues Gefühl von Zugehörigkeit.
Da war nun eine große Gruppe, wie eine Familie die zusammenhielt, wo alle gleich waren. Jeden Morgen standen sie zusammen auf, tranken den gleichen Tee, aßen vom gleichen Brot und gestalteten jeden Tag gleich.
Das Herz war glücklich – eine Zeitlang, bis es spürte, dass auch dies nicht das richtige Ziel sein konnte, denn auch seinen vielen neuen Freunden fehlte etwas – die Individualität.
In ihrer Mitte gab es keinen Platz für jemanden, der eigenständig war und sein Leben selbst planen wollte. Also löste sich das Herz auch aus dieser Verbindung und genoss sein eigenes Leben.
Es ging über 112 Wege, um 203 Kurven und 24 Berge und Täler, bis es an einem Haus ankam, dass mit Stacheldraht umzogen war.
Aus dem Schornstein quoll Rauch, das hieß, dass tatsächlich jemand in diesem Haus leben würde.
In einem Haus, das nicht einmal Fenster hatte.
Bei dem Anblick fiel dem Herz ein, wie es selbst einmal gelebt hatte.
Wie sehr es damals gehofft hatte, dass jemand ihm helfen würde und doch niemand sein stummes Flehen erkannt hatte.
Es wusste, dass es ihm aus eigener Kraft gelungen war und es war sehr stolz darauf.
Aber wie konnte es diesem armen Herzen helfen aus seinem Verlies zu kommen?
So besorgte sich das Herz eine Drahtschere und versuchte den Stacheldraht zu durchtrennen. Aber nach einiger Zeit verließen es die Kräfte.
Auch dieses Herz hatte keine Mühe gespart, für sich den stärksten Stacheldraht zu finden.
Obwohl das Herz das andere nicht sah und auch nicht hörte, sondern nur ahnen konnte was das für ein Herz war, fühlte es eine starke Bindung zu ihm.
So grub es ein Loch im Boden unter dem Stacheldraht, um den anderen wenigstens nah zu sein.
So stand es vor seinem Haus, vor der gleichen dicken Stahltür wie einst seiner und begann zu reden.
Tagelang, Nächtelang stand es einfach nur da und redete.
Es erzählte von seinem Schicksal. Erzählte ihm, was ihm alles in seinem Leben widerfahren war und es hörte ein schluchzen hinter der dicken Tür. Unermüdlich sprach das Herz weiter. über die lustigen Sachen, die es mit seinem 1. „Freund“ erlebt hatte, über die Wärme , die es bei seiner Familie erfahren hatte und es vernahm ein leises glucksen von innen. Erst leise, bis es immer lauter sich in ein gellendes Lachen verwandelte.
Plötzlich sprach das Herz hinter der Stahltür zu ihm.
Es wollte hinaus zu ihm, und es sehen. Es wollte mit ihm gehen und mehr von dem Lachen und Weinen. Es wollte sich an seine Schulter lehnen, sich an es drücken und es nie wieder verlassen.
Das Herz war glücklich, endlich so jemanden gefunden zu haben, aber was sollte es nur tun?
Wie auch bei ihm früher, wusste das andere Herz nicht mehr wo es den Schlüssel versteckt hatte.
So fasste das Herz den Entschluss loszugehen um den Schlüssel zu suchen. Nur wo sollte es anfangen ?
Es lief ziellos umher, suchte hinter Büschen, auf Bäumen, tauchte in Seen danach; fragte alle die seinen Weg kreuzten, aber niemand wusste Rat und nirgends fand es den Schlüssel.
So ging es mit schwerem Herzen zurück zu der kleinen Hütte, krabbelte durch das Loch unterm Zaun, um die schlechte Nachricht zu überbringen.
Doch zu seinem Erstaunen, fand es die schwere Stahltür geöffnet.
Wie war das möglich gewesen? -dachte das Herz.
Plötzlich hörte es eine freundliche und liebevolle Stimme hinter sich.
Da sah es ein kleines blassrosa Herz stehen mit glühenden Wangen. “ Ich habe hier auf dich gewartet“ sagte das kleine Herz. “ Ich habe erkannt, dass man es im Leben nur aus eigener Kraft schaffen kann, aus seinem Gefängnis zu entkommen. Doch so viel Kraft konnte ich nur durch dich erlangen. Durch deine Liebe zu mir und meiner Liebe zu dir habe ich den Schlüssel zur Tür meines Herzens gefunden, der mir gleichzeitig die Tür meines Verlieses öffnete “
Sie nahmen sich an die Hand und gingen von nun an alle Wege gemeinsam, ihr Herzschlag im gleichen Rhythmus bis an ihr Lebensende.
Ende
Diese Geschichte schickte mir die AnTaRa 🙂
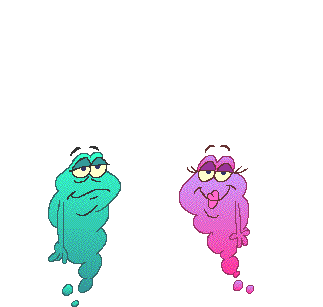
Traumfänger
Geschichte aus der Tradition der native people der Stämme der Sioux und Ojibwa
Vor langer Zeit kam eine traurige Frau des Stammes der Ojibwa-Indianer zur weisen alten Spinnenfrau. Sie erzählte der weisen Spinnenfrau, dass ihre kleine Tochter nachts von bösen Alpträumen heimgesucht werde und deshalb schlecht schlafen könne.
In ihrer Verzweiflung bat die Mutter die weise Spinnenfrau um einen Rat. Die Spinnenfrau antwortete: „Nimm andächtig einen Zweig von der Weide am Fluss und biege ihn zu einem heiligen Kreis. Fülle den Kreis mit einem Spinnengeflecht aus. Danach hänge ihn über den Schlafplatz deines Kindes. Die bösen Träume werden sich in diesem Gespinst verfangen, die guten Träume finden weiterhin den Weg zu deiner Tochter.“
Die Indianerin beherzigte die weisen Worte der Spinnenfrau und fertigte danach den ersten Traumfänger. Von diesem Zeitpunkt an schlief die Tochter wieder ruhig.
diese Geschichte schickte mir die alusru 🙂
Genieße das Leben
Lies dies und lass es auf Dich einwirken – dann wähle selbst, wie Du den morgigen Tag beginnen willst!!
Michael war so eine Art Typ, der Dich wirklich wahnsinnig machen konnte.
Er war immer guter Laune und hatte immer was positives zu sagen.
Wenn ihn jemand fragte, wie’s ihm ginge, antwortete er: „Wenn’s mir besser gehen würde, wäre ich zwei Mal vorhanden.
Er war der geborene Optimist. Hatte einer seiner Angestellten mal einen schlechten Tag, meinte Michael zu ihm, er solle die positive Seite der Situation sehen.
Seine Art machte mich wirklich derart neugierig, dass ich eines Tages auf ihn zuging und zu ihm sagte: „Das kann ich einfach nicht verstehen.
Du kannst doch nicht ständig ein positiv denkender Mensch sein, wie machst Du denn das?“
Michael entgegnete: „Wenn ich am Morgen aufwache, sage ich mir: „Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst wählen, ob Du guter oder schlechter Laune sein willst. Und ich will eben guter Laune sein.
Jedes Mal, wenn etwas passiert, kann ich selbst wählen, ob ich der Leidtragende einer Situation sein oder ob ich etwas daraus lernen will.
Jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt, um sich zu beklagen, kann ich entweder sein Klagen akzeptieren oder ich kann auf die positive Seite des Lebens hinweisen. Ich habe die positive Seite gewählt.“
„Ja, gut, aber das ist nicht so einfach“, war mein Einwand.
„Doch, es ist einfach“, meinte Michael, „das Leben besteht aus lauter Auswahlmöglichkeiten. Du entscheidest, wie Du auf gewisse Situationen reagieren willst.
Du kannst wählen, wie die Leute Deine Laune beeinflussen.
Dein Motto ist: Du kannst darüber entscheiden, wie Du Dein leben führen willst.“
Ich dachte darüber nach, was Michael gesagt hatte.
Kurze Zeit später verließ ich Tower Industry, um mich selbstständig zu machen.
Wir verloren uns aus den Augen, aber ich dachte oft an ihn, wenn ich mich für das Leben entschied, statt darauf zu reagieren.
Einige Jahre später erfuhr ich, dass Michael in einen schweren Unfall verwickelt war. Er stürzte etwa 18 m von einem Fernmeldeturm. Nach 18 Stunden im Operationssaal und Wochen intensiver Pflege, wurde Michael mit Metallstützen in seinem Rücken aus dem Krankenhaus entlassen. Als ich ihn fragte, wie es ihm ginge, erwiderte er: „Wenn es mir besser ginge, wäre ich zwei Mal vorhanden.
Möchtest Du meine Operationsnarben sehen?“
Ich verzichtete darauf, fragte ihn aber, was in ihm vorgegangen sei im Augenblick des Unfalls.
„Nun das erste, was mir durch den Kopf ging war, ob es meiner Tochter, die bald darauf zur Welt kommen sollte, gut ginge. Als ich dann so am Boden lag, erinnerte ich mich, dass ich zwei Möglichkeiten hatte:
Ich konnte wählen, ob ich leben oder sterben wollte.“
„Hattest Du Angst? Hast Du das Bewusstsein verloren? „wollte ich wissen.
Michael fuhr fort: „Die Sanitäter haben wirklich gute Arbeit geleistet.
Sie hörten nicht auf, mir zu sagen, dass es mir gut ginge. Aber als sie mich in die Notaufnahme rollten, sah ich den Gesichtsausdruck der Ärzte und Schwestern, der sagte: ‚Er ist ein toter Mann.‘
Und ich wusste, dass ich die Initiative ergreifen musste.“
„Was hast Du denn getan?“ fragte ich ihn.
„Nun, als mich so ein Ungetüm von Aufnahmeschwester mit lauter Stimme befragte und wissen wollte, ob ich auf irgendetwas allergisch sei, bejahte ich.
Die Ärzte und Schwestern hielten inne und warteten auf meine Antwort.
Ich atmete tief durch und brüllte zurück: ‚Auf Schwerkraft!‘
Während das ganze Team lachte, erklärte ich ihm:
„Ich entscheide mich zu leben.
Also operieren Sie mich, als wäre ich lebendig und nicht tot.“
Michael überlebte dank der Fähigkeit seiner Ärzte, aber auch wegen seiner bewundernswerten Einstellung.
Von ihm lernte ich, dass wir jeden Tag die Wahl haben, in vollen Zügen zu leben.
Die Einstellung ist schließlich alles.
Deshalb sorge Dich nicht um das, was morgen sein wird.
Jeden Tag gibt es genug, um das man sich sorgen muss. Und das Heute ist das Morgen, über das Du Dir gestern Sorgen gemacht hast.
GENIESSE DAS LEBEN, DENN ES IST DAS EINZIGE, DAS DU HAST…
diese Geschichte schickte mir auch die alusru 🙂

Die kleine Seele
Es war einmal eine kleine Seele, die eines Tages sehr aufgeregt zu Gott lief und sagte: „Ich weiß, wer ich bin.“
Gott sagte: „Das ist schön, und wer bist du?“
Die kleine Seele sagte: „Ich bin das Licht.“
Gott sagte: „Das ist richtig, du bist das Licht.“
Die Seele überlegte eine Sekunde lang und sagte dann: „Aber ich will das Licht SEIN!“
Gott sagte: „Aber du bist das Licht.“
Die Seele sagte: „Ich weiß, dass ich das Licht bin, aber ich will das Licht SEIN! Ich will mich selbst als das Licht erfahren. Ich will mich selbst durch meine eigene Erfahrung erkennen.“
Gott sagte: „Oh, ich verstehe, du willst erfahren, zu sein, wer du bereits bist.“
Die kleine Seele sagte: „Ja, genau. Ich will mich selbst als das Licht erfahren, es nicht nur wissen, sondern erfahren, wie es ist, das Licht zu sein.“
Gott antwortete: „Das ist verständlich, aber es ist auch eine Herausforderung, denn weißt du, es gibt nichts anderes als das Licht. Denn Ich habe nichts erschaffen außer dem Licht. Denn du bist wie eine Kerze in der Sonne. Oh, sicher bist du hier, zusammen mit einer Billion, Billion, Billion anderer Kerzen, die die Sonne ausmachen. Aber die Sonne wäre nicht die Sonne ohne dich. Sie wäre dann eine Sonne, der eine ihrer Kerzen fehlt, und damit wäre sie gar nicht mehr die Sonne, denn sie würde nicht mehr so hell scheinen. Doch wie du dich selbst inmitten des Lichtes als Licht erkennen kannst, das ist wirklich ein Problem“, sagte Gott.
„Nun,“ sagte die kleine Seele, „Du bist Gott, denk Dir was aus.“
Gott sagte: „Ich werde und Ich habe. Was wir tun werden: Du kannst dich inmitten des Lichtes nicht selbst als Licht erkennen, also werden wir dich mit dem umgeben, was du nicht bist. Wir werden uns gemeinsam das vorstellen, was du nicht bist, und wir werden dich damit umgeben, und wir werden es die Dunkelheit nennen. Wir werden dich mit der Dunkelheit umgeben. Wir werden dich mit dem Gegenteil dessen umgeben, was du bist, so dass du in deiner Erfahrung erkennen kannst, wie hell du leuchtest.“
Die kleine Seele sagte: „Okay, ich bin bereit. Bring die Dunkelheit her, damit ich das Licht sein kann.“
Gott sagte: „Das werde Ich, denn du hast Mich darum gebeten und es verlangt. Ich werde dich mit der Dunkelheit umgeben, doch in dem Moment, wo du dich derart von der Dunkelheit umgeben siehst, recke nicht deine Faust gen Himmel und verfluche die Dunkelheit. Sei ein Licht in der Dunkelheit, um zu erkennen, wer du wirklich bist und damit alle, deren Leben du berührst, ebenso erkennen mögen, wer sie wirklich sind. Las dein Licht so vor den Menschen leuchten, dass sie ihren eigenen Glanz in dir widergespiegelt sehen. Du kannst das mit jedem gewünschten Aspekt der Göttlichkeit tun,“ sagte Gott zu der kleinen Seele. „Also wähle gut und wähle weise hierin und in deinen vielen Leben. Denn Leben hat als Ziel der „Seele“ das Wählen und Sein eines Aspektes von mir, der du bist.“ Gott sagte: „Was wählst du also in diesem nächsten Leben?“
Die kleine Seele sagte aufgeregt: „Wow, wow, ich kann alles sein, was Du bist.“
Gott sagte: „Ja, alles oder irgendein Teil davon. Hier sind deine Wahlmöglichkeiten, also welche wählst du?“
Die kleine Seele sagte: „Du meinst, im nächsten Leben? Ich kann Glück oder Freude sein, oder Weisheit oder Frieden oder Liebe oder oder..“
„Das ist richtig“, sagte Gott.
Die kleine Seele sagte: „Ich wähle… ich wähle, dass… das heißt… was ich sein will… ich will erfahren, dass…“
Gott sagte: „Meine Güte, dies ist dein großer Tag. Du hast Vergebung gewählt. Du willst vergebend sein.“
„Ja, ja,“ sagte die kleine Seele, „das heißt, was ich tun will, ist, mich selbst als Vergebung zu erfahren.“
„Nun,“ sagte Gott, „es gibt nur ein Problem, du siehst, es gibt niemanden, dem du vergeben könntest.“
„Niemand?“ sagte die kleine Seele.
Gott antwortete: „Schau dich um, siehst du irgend jemanden, der weniger vollkommen, weniger schön, weniger wunderbar wäre als du?“
In diesem Moment drehte sich die kleine Seele um und sah, dass all die Seelen des Universums zusammengekommen waren, denn sie hatten die Unterhaltung der kleinen Seele mit Gott mit angehört. Die Seele schaute sich um und alles, was sie sah, war Wunder, Schönheit und Vollkommenheit. Sogar sie selbst war vollkommen, und sie konnte Vollkommenheit überall sehen und die kleine Seele sagte: „Also kann ich nichts als Vollkommenheit überall sehen. Wem soll ich dann vergeben? Denn es gibt niemanden, der weniger vollkommen wäre als ich. Wie soll ich Vergebung erfahren?“
In dem Moment trat eine freundliche Seele aus der Gruppe vor. „Verzweifle nicht. Du kannst mir vergeben.“
Die kleine Seele sagte: „Dir? Wer bist du?“
Die freundliche Seele antwortete: „Ich bin eine unter vielen, ich habe mich entschieden, vorzutreten. Ich werde dir jemanden geben, dem du in deinem nächsten Leben vergeben kannst. Ich werde in diesem deinem nächsten Leben etwas tun, das du mir vergeben kannst.“
„Was, was?“ sagte die kleine Seele. „Was wirst du tun?“
„Oh,“ antwortete die freundliche Seele, „uns wird schon etwas einfallen.“
„Aber, aber, warum?“ sagte die kleine Seele. „Würdest du das tun? Denn du bist ein Objekt der Schönheit wie ich. Ein Wesen von totaler Vollkommenheit, dessen Licht durch die reine Schwingung deines gesegneten und glanzvollen Selbst erzeugt wird. So schnell schwingst du und leuchtest du, dass ich dich gar nicht ansehen kann. Was könnte dich dazu bewegen, deine Schwingung auf eine derartige Geschwindigkeit zu verlangsamen, dass du schwer genug würdest, um diese schreckliche Sache zu machen? Warum würdest du das tun?“
Die freundliche Seele sagte: „Es ist ganz einfach, ich würde es tun, weil ich dich liebe. Oh, und schau nicht so überrascht. Du hast es für mich auch schon getan. Erinnerst du dich nicht? Hast du mich so schnell vergessen? Du und ich, wir haben diesen Tanz schon einmal getanzt. Wir haben all das durchgemacht. Erinnerst du dich nicht? Wir waren am Boden und an der Spitze, wir waren links und rechts. Das Vorher und das Nachher. Wir waren das Gute und das Schlechte. Wir haben all das für einander durchgemacht. Sicher erinnerst du dich daran, als ich das Opfer war und du der Täter? Sicher erinnerst du dich, aber mit einem liegst du richtig. Es wird nicht einfach sein, meine Schwingung zu verlangsamen, genau, wie du gesagt hast. Es ist keine leichte Sache, also bitte ich dich in diesem nächsten Leben um einen Gefallen. Nämlich, dass du vergebend sein wirst.“
„Was, was?“, sagte die kleine Seele. „Ich werde alles tun, alles. Ich bin dabei, mich selbst als der zu erfahren, der ich bin. Wie könnte ich mich denn bei dir revanchieren?“
Die freundliche Seele antwortete: „In dem Moment, wo ich dich schlage und anspucke, in dem Moment, in dem ich dir das Schlimmstmögliche antue, was du dir vorstellen kannst, in eben jenem Moment erinnere dich, wer ich wirklich bin. Denn wenn du mich vergisst, wie ich jetzt bin, werde ich mich überhaupt nicht mehr an mich selbst erinnern. Noch schlimmer, du wirst auch dem Vergessen anheimfallen, und dann werden wir beide vergessen haben, wer wir wirklich sind, dann werden wir eine dritte Person brauchen, die uns hilft, uns zu erinnern.“
Die kleine Seele antwortete: „Ich werde nicht vergessen. Ich werde nicht vergessen. Ich werde mich selbst im schlimmsten Moment daran erinnern.“

Eine Versammlung von Engeln
von Dennis J. Balagtas
Diana Peterson, Selbstmordopfer, 36 Jahre alt, erschien vor einer Reihe von elf Engeln. Diese waren zuständig für die Führung der Akten. Als sie so vor ihnen stand, bat man sie höflich, sich zu setzen. Der Hauptengel sagte: »Meine Liebe, wir müssen für die Akten ein paar wichtige Dinge wissen. Als Erstes: Warum wähltest du, dein Leben früher als geplant zu beenden? Und zweitens möchten wir dich bitten, den Vertrag für dein nächstes Leben vorzubereiten und zu entscheiden, wohin du als nächstes gehen möchtest.«
Diana saß da und fühlte sich irgendwie unreal. »Ich dachte, dass ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe«, sagte sie.
»Oh nein«, antwortete ein Engel. »Das ist wirklich nur ein Mythos. Es gibt so viele Dinge, die du lernen musst; wie kannst du annehmen, dass du all dies in nur einem Leben schaffen könntest? Nein, wir geben dir eine ganze Reihe Chancen, die Dinge zu lernen, die du begreifen willst. Wir haben dich hierher kommen lassen, damit du wählen kannst, wann du gehen und in welche Lebensumstände du kommen willst.«
Diana schnappte nach Luft. Dies war etwas völlig anderes als alles, was man sie jemals gelehrt hatte. »Also … ääh … Ich denke, dann erzähle ich euch besser, woher ich komme. Ihr müsst wissen, ich wuchs bei sehr lieblosen Eltern auf. Sie kümmerten sich nicht wirklich um mich oder sprachen mit mir. Normalerweise waren sie mit ihrem eigenen Leben und ihren Freunden beschäftigt. Ich habe mich nicht wirklich von ihnen unterstützt gefühlt. Sie haben mich nie an sich gedrückt. In der Tat habe ich sie nie sich in meiner Gegenwart umarmen oder küssen gesehen. Ich nehme an, dies ist der Grund, warum ich mir selbst gegenüber so kalt und distanziert bin.
Außerdem war mein Berufsleben so ausweglos. Ich wusste einfach nicht, was ich werden sollte und versuchte mich in mehreren Jobs. Ich schien zwar genug Fähigkeiten für eine ganz bestimmte Tätigkeit zu haben, aber die wurde nicht sehr gut bezahlt. Das Geld war immer knapp, und ich musste doch zwei Kinder unterstützen. Mein Traumberuf war immer der einer Schauspielerin. Ich hatte auch nicht viele Freunde, nur einen oder zwei. Oft sind sie einfach gegangen, und das war’s. Und ich sehe ein wenig sonderbar aus. Manche Leute sagen, ich sei hübsch, aber ich glaube es reicht nicht, um mit den meisten Menschen mitzuhalten. Wisst ihr, ich bin nicht wie die gewöhnlichen Menschen, da ich eine Menge ungewöhnlicher Ideen habe und meine Handlungsweisen nicht wirklich normal sind. Ich mag es, mit mir allein zu sein und nachzudenken. Ich mag es, zu spielen. Ihr seht also, ich passe da nicht wirklich hin.
Dazu kommt, dass ich oft krank war. Ich verfügte nicht über allzu viel Energie, war immer müde und musste viel Zeit im Bett verbringen. Es gab Momente, in denen ich sehr gereizt auf meine Kinder reagierte; sie kamen immer in mein Zimmer und unterbrachen mich, wenn ich beim Nachdenken war. Ich glaube, ich war keine gute Mutter, denn ich hatte keinen Spaß daran, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Oft wusste ich nicht mal, wo sie gerade waren. Ich denke auch nicht wirklich, dass sie sich aus mir etwas machten. Ich bin es auch müde, eine unwichtige Kleinigkeit zu sein, von der die Leute alles haben können, was sie wollen.
Ich hatte immer Angst davor, ‘nein’ zu sagen und fühlte mich dann, als ob ich ein schlechter Mensch sei. So bin ich all dessen müde geworden. Ich dachte: ‘Ich will hier nicht mehr leben. Ich gebe es einfach auf, geh in den Himmel und vielleicht kann ich mich dort ausruhen.’ Doch das scheint nicht wahr zu sein. Nachdem, was ihr mir gesagt habt, muss ich wieder dort hingehen.« Diana machte eine Atempause.
Einer der Engel sagte laut: »Ja, es trifft zu, dass du zurückgehen musst; doch bevor du gehst, kannst du wählen, was immer du für dich und dein nächstes Leben willst. Da wir nun wissen, warum du dich umgebracht hast und nun hier bist, möchtest du vielleicht einen neuen Vertrag mit uns machen.«
»Du liebe Zeit, ich glaube, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich kannte eine Menge Spanier, die aus großen, einander liebenden Familien kamen. Sie wirkten immer so vergnügt und großzügig. Ich glaube, wenn ich schon zurückgehen muss, dann würde ich gern in einer spanischen Familie leben, vielleicht in Kalifornien. Manchmal habe ich auch schwarze Familien gesehen, die so liebevoll und süß wirkten. Das einzige Problem ist, dass ich nicht unter Vorurteilen leiden möchte, wenn ich mich für eine solche Familie entscheide. In Ordnung, lasst mich sehen – ich möchte nicht allzu hart arbeiten müssen. Entweder möchte ich einen reichen Mann heiraten oder gewandt genug sein, um selbst eine Menge Geld zu verdienen. Ich möchte an den Punkt kommen, wo ich nicht mehr arbeiten muss, wenn ich es nicht will und meinen Beruf wirklich lieben kann. Ich bin es so müde, immer in einer Sackgasse zu sitzen.
Ich möchte kreativ sein und das Gefühl haben, durch meinen Beruf etwas zur Welt beitragen zu können. Ich wäre gerne eine nette Persönlichkeit mit vielen Freunden, die von allen gemocht wird. Trotzdem hätte ich gerne Zeit für mich, wenn ich das will; und ich möchte hübsch und schön sein und eine gute Figur haben. Man sollte mich mögen, aber nicht nur wegen meines Aussehens. Ich möchte ebenso von schönem Inneren wie auch Äußeren sein, so dass jeder von mir sagt: ‘Sie ist eine wundervolle Person.’ Ich glaube, das würde mir sehr gefallen. Ich hätte auch gern eine gute, robuste Gesundheit und möchte mehr mit Leuten zusammen sein. Oh, da fällt mir noch etwas ein: Ich würde gerne die Menschen lieben. Es scheint mir jetzt, als wenn ich mich nie um andere gekümmert hätte, und ich möchte wirklich für andere da sein.
Das Nächste ist, dass ich entweder eine liebevolle Mutter sein oder für eine Zeit lang gar keine Kinder haben möchte. Vielleicht wäre das eine gute Idee, bis ich gelernt habe, eine bessere Mutter zu werden. Wenn ich all die Dinge tue, für die ich mich jetzt entschieden habe, werde ich wohl auch nicht genug Zeit für Kinder haben.
Als Letztes möchte ich mich behaupten können. Ich möchte tun, was ich will, ohne dass jemand etwas dagegen hat oder mich dafür verurteilt. Ich möchte frei sein, zu kommen und zu gehen, wie ich will.«
»Gut, Diana, das klingt nach einem recht eindrucksvollen Vertrag«, sagte der Engel, »ich denke, wir können all das für dich arrangieren. Ich habe nur noch eine Frage zum Vertrag. Was möchtest du in deinem nächsten Leben vollenden?«
»Oh«, antwortete Diana. »Meinst du damit, dass ich selbst entscheiden muss, was ich vollenden will?«
»Natürlich«, sagte der Engel, »das ist es, worum es hier geht.«
»Also gut, lasst mich überlegen … die einzige Sache, die mir einfällt, ist zu verstehen, worum es bei der Liebe eigentlich geht. Ich denke, das würde ich gerne zum Abschluss bringen. Nein, eigentlich möchte ich lieber meine Selbstliebe vervollkommnen und lernen, wie ich mir eigenständig genug Freude, Geld und Sicherheit geben kann, so dass ich nicht mehr den Wunsch haben müsste, zu sterben.«
»Das klingt hervorragend«, meinte ein anderer Engel. »Ich denke, wir haben nun einen guten Vertrag. In Ordnung, hier ist eine Kopie für dich; die andere geben wir zu unseren Akten.«
»Wisst ihr was?« sagte Diana, »einen Moment lang dachte ich, ich käme in die Hölle, weil ich mich selbst umgebracht habe. Jetzt erzählt ihr mir, dass ich nicht in den Himmel komme. Heißt das, ich muss doch in die Hölle?«
»Du meine Güte«, antwortete der Engel, »wo hast du nur diese Geschichten gehört? Es gibt keinen Ort, der dich bestraft. Wir glauben nicht an Bestrafung und ebenso wenig an Belohnung. Wir glauben nur an die Liebe. Darüber hinaus wissen wir, dass Himmel und Hölle in dir drin sind. Wenn du auf eine bestimmte Art denkst, fühlt es sich an wie im Himmel; doch wenn du dein Leben auf eine andere Weise betrachtest – ich bin sicher, du selbst kannst uns sagen, dass es wie die Hölle ist.«
»Das ist wahr«, bestätigte Diana. »Ich habe nie auf diese Weise darüber nachgedacht. Um festzustellen, ob man im Himmel oder in der Hölle ist, muss man sich bewusst machen, wie man die Dinge sieht. Nur ich selbst kann mich bestrafen oder belohnen.«
»Ach ja, vielleicht möchtest du etwas über deinen letzten Vertrag erfahren. Du könntest es sehr interessant finden,« sagte ein weiterer Engel.
»Ich hätte nicht gedacht, dass es da einen alten Vertrag gibt.«
»Ja, wir würden dir gerne etwas über den Vertrag erzählen, den du abgeschlossen hast, bevor du in das Leben von Diana Peterson gingst. Zuvor starbst du 1926 in Italien. Du hattest elf Kinder, und es gab viel harte Arbeit. Du hattest eine sehr große, dicht geschlossene Familie, viele Verwandte und immer gut und genug zu essen. Du warst eine volle, robuste und energiegeladene Frau. Du batest darum, in deinem nächsten Leben Eltern zu bekommen, die dir die Möglichkeit geben sollten, dich als geschickte Persönlichkeit zu erfahren, die dir Freiheit lassen und dir darin vertrauen, für dich selbst sorgen zu können. Sie sollten dich gehen lassen, wohin du willst, ohne dir immer über die Schulter zu sehen.
Außerdem wolltest du einen Männerberuf haben. Du wolltest Zeit zum Träumen, Nachdenken und Kreativsein. Du wünschtest wenige Menschen um dich herum, damit du Raum zum Atmen hast – nur ein paar Freunde und eine kleine Familie. Du wolltest groß und dünn sein, um nicht laufend zu hören, was für eine schöne Frau, was für eine gute Mutter oder nette Person du seist. Du wolltest einzigartig sein und herausragen, um – vielleicht wie die Frauen in den Filmen – andersartige Dinge zu tun. Du sagtest auch, dass du – da du mit all den Kindern, dem Kochen und Sauberhalten des Haushaltes so hart zu arbeiten hattest – dieses Mal nicht so viel Arbeit zu tun haben wolltest und schlugst vor, vielleicht ein wenig krank sein zu können, so wie die Kameliendame. Du wolltest allein sein können und wünschtest dir wenige oder gar keine Kinder, um auszuruhen. Wenn du überhaupt Kinder wolltest, sollten sie unabhängig sein. Auch wünschtest du dir, etwas damenhafter und ruhiger zu werden, weil du zuvor eine recht lautstarke Persönlichkeit hattest. Dies waren die Punkte deines letzten Vertrages.«
Diana war erstaunt. Zwei kleine Tränen liefen ihre Wangen hinunter. »Mir scheint, ich habe bekommen, was ich wollte. Eltern, die mir Freiraum gaben, mehr Ruhe, nicht so harte Arbeit. Ich war recht kreativ und habe sogar manchmal in Schauspielstücken mitgewirkt. Ich bin so verwirrt – ich habe mich umgebracht, weil ich bekam, was ich wollte!« Sie schlug die Hände vor das Gesicht.
»Nein, nein«, sagte der jüngste Engel freundlich. »Es war die Art, wie du über dich in deinem Leben dachtest, nämlich als unglückliche Versagerin, die dich den Tod wählen ließ.«
»Du kannst alle von dir gewünschten Veränderungen haben«, meinte ein anderer Engel und klopfte Diana auf die Schulter. »Du bist nicht auf ewig verdammt. Du kannst solange immer wieder zurückgehen, bis du gelernt hast, dass nicht das zählt, was du hast, sondern was du bist. Wenn du dich selbst und andere wirklich lieben kannst, bist du im Himmel.«
Plötzlich wurde alles schwarz. Das Nächste, was Diana hörte, war die Stimme des Arztes: »Es ist ein wunderschönes kleines Mädchen, Mrs. Sanchez.« Der Arzt war überrascht, weil das Mädchen nicht weinte.

Ein kleiner Junge will Gott treffen
Es war einmal ein kleiner Junge, der unbedingt Gott treffen wollte. Er war sich darüber bewusst, dass der Weg zu dem Ort, an dem Gott lebte, ein sehr langer war.
Also packte er sich einen Rucksack voll mit einigen Coladosen und mehreren Schokoladenriegeln und machte sich auf die Reise.
Er lief eine ganze Weile und kam in einen kleinen Park. Dort sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute, die vor ihr nach Futter auf dem Boden suchten.
Der kleine Junge setzte sich zu der Frau auf die Bank und öffnete seinen Rucksack. Er wollte sich gerade eine Cola herausholen, als er den hungrigen Blick der alten Frau sah.
Also griff er zu einem Schokoriegel und reichte ihn der Frau.
Dankbar nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an.
Und es war ein wundervolles Lächeln! Der kleine Junge wollte dieses Lächeln noch einmal sehen und bot ihr auch eine Cola an. Und sie nahm die Cola und lächelte wieder – noch strahlender als zuvor.
Der kleine Junge war selig. Die beiden saßen den ganzen Nachmittag lang auf der Bank im Park, aßen Schokoriegel und tranken Cola – aber sprachen kein Wort.
Als es dunkel wurde, spürte der Junge, wie müde er war und er beschloss, zurück nach Hause zu gehen.
Nach einigen Schritten hielt er inne und drehte sich um. Er ging zurück zu der Frau und umarmte sie.
Die alte Frau schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln.
Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem Gesicht und fragte: „Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?“
Und der kleine Junge antwortete: „Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen – und sie hat ein wundervolles Lächeln!“
Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn schon auf sie wartete. Auch er fragte sie, warum sie so fröhlich aussah.
Und sie antwortete: „Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen – und er ist viel jünger, als ich gedacht habe.“
Mothvana Land
Unter einer Rinde eines großen Baumes sitzen eine Anzahl von Raupen.
Sagt eine Raupe: „Glaubt jemand von euch Leuten wirklich an Mothvana „?
Antwortet eine andere: „Nur ein Mythos, einige alte Rindenschriften, wer kümmert sich um diese Verrückten?
Wir sind jetzt so fortschrittlich, wir sind auf dem Gipfel der Entwicklung! Ich glaube an Evolution und … “
Unterbricht eine andere: „Diese Frage ist so alt wie das Raupengeschlecht. Sogar mit der ganz neuen Technologie gibt es keine endgültige Antwort „.
Eine andere fragt: „Was..ist..Mothvana? Können Sie es definieren? Können Sie es beobachten? Können Sie es messen? Hat es einen Anfang, hat es ein Ende?
Leute, wo sind eure wissenschaftlichen Methoden? Kommt, lasst uns eine Pause machen und mit diesem Mumbo Jumbozeug … “
Und wieder sagt eine andere: „Selbst wenn es existieren würde, wer wollte dort sein wollen? Keine schöne Rinde an der man sich reiben kann! Selbst wenn diese Gerüchte wahr wären, wollte man nicht auf diesem Baum sein. Was für ein fürchterlicher Gedanke.“
Eine sagt „Ja! Außerhalb dieses Baumes kann es nichts anderes geben, als die Leere! Nichts „!
Und eine der älteren Raupen sagt: „Ich habe die Heilige Schrift der Heiligen Rinden mein ganzes Leben studiert, und ich sage euch: Glaubt, und ihr werdet gerettet! Bereut jetzt, oder der mächtige Specht schluckt euch sonst für alle Ewigkeit „!
„Ja, ja „scherzt eine andere,“ und was kommt dann – die grüne Baumeidechse?
Kommt, lasst uns saftige Rinde kauen und unser Leben genießen“!
„Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass es auch andere Bäume gibt, „sagt eine und alle lachen.
„Ich bin mir sicher, dass wir wenn wir uns einen Weg durch die Rinde fressen, dann schließlich frei sein werden, “ behauptet eine.
„Frei wovon? Welcher Zweck sollte das haben?
Dieser Baum ist alles, was zählt – alles andere sonst, ist eine wilde Spekulation. Opium für die Raupen. Lasst uns zusammenschließen – um uns zu vergewissern, dass niemand ein besseres Stück der Rinde bekommt, als der Rest von uns!“
Eine andere Raupe sagt mit Überzeugung: „Ich weiß, dass es einen Ausgang aus diesem Baum gibt! Aber ich werde nicht gehen, bis jedes lebende Wesen in diesem Baum, zuerst einen Ausgang gefunden hat, „!
„Ich auch, „kündigt noch eine an.
„Alberne Leute, “ lehnt jemand ab. „wenn ihr beide das Bedürfnis habt als Letzte zu gehen, dann wird keiner von uns je fähig sein zu gehen. Könnt ihr das verstehen?
Plötzlich gibt es einen Aufruhr in der Kolonie. „Ich kann das Licht sehen „! schreit jemand.
„Oh, nein! Wieder einer dieser verrückten Sektierer „! seufzen die Leute.
„Ich breche zur anderen Seite durch „beharrt die Raupe..
„Du musst Drogen genommen haben, „sagt jemand zu ihr.
„Niemand ist jemals hinausgegangen und zurückgekommen, um darüber zu reden.
Dies ist Beweis genug dafür, dass der ganze Mothvana Mist nichts ist, als das Produkt eines wahnsinnigen Verstandes, “ verkündet eine der Raupen.
„Nein, Nein „schreit die Raupe, die das Licht sah.
„Unser seidiger Körper ist nur eine Hülse, ein Käfig, wirklich! Sobald ihr euch frei macht, können ihr ihn verlassen. Und sogar den Baum „!
„Komm jetzt zurück, alberner Junge „! schreit seine Mutter.
„Es ist unmöglich, von diesem Baum frei zu werden, „! sagen einige kluge Leute.
„Man muss zuerst Mitglied des Ordens der aufgeklärten Raupen werden. Es gibt keine wertvollen Larven außerhalb unserer heiligen Gemeinschaft! Dies muss ein trauriger Fall von Wahnvorstellung sein „.
„Ja, „fügt eine andere weise Raupe hinzu,“ außerdem kann es keine Rettung geben, bevor nicht der nächste erleuchtete Weise in diesem Baum erscheint „!
Und die Politiker der Raupengemeinschaft rufen die Raupenpolizei, um ihn einzusperren.
„Diese verrückten Ideen sind unsozial, Zeichen einer tief gestörten Mentalität. Eine Bedrohung der Gesellschaft „.
„Beunruhigen Sie sich nicht, „sagt ein Wissenschaftler. „Glücklicherweise haben wir ein neues Medikament entwickelt, das hilft diese Symptome zu mildern. Es ist nicht billig. Wir gaben viele Millionen von Dollars für seine Entwicklung aus “
Aber, als sie die Raupe erreichten, die das Licht gesehen hatte, war alles, was sie finden konnten, eine leere Hülse.
Inzwischen sah die sich entfaltende Raupe, dass die Mothvana Länder die Himmel waren.
Und sie sah ihre farbigen Flügel und erkannte, dass sie ein schöner Schmetterling war .
Und in der Morgendämmerung eines neuen Tages breitete dieser Schmetterling seine Flügel aus …. “
Mothvana Land übersetzt aus
Pnohteftu – The little purple Notebook on how to escape from this Universe.
Von Maximilian Sandor
Die Meditation im Boot

„Ein Mönch beschließt, alleine zu meditieren.
Weg von seinem Kloster nimmt er ein Boot und fährt in die Mitte des Sees, schließt die Augen und beginnt zu meditieren. Nach einigen Stunden ungestörter Stille, spürt er plötzlich den Schlag eines anderen Bootes, das seines trifft. Mit noch geschlossenen Augen spürt er, wie seine Wut aufsteigt, und als er die Augen öffnet, ist er bereit, den Bootsmann anzuschreien, der es gewagt hat, seine Meditation zu stören.
Aber als er seine Augen öffnete, sah, dass es ein leeres Boot war, das nicht vertäut war und mitten auf dem See trieb …
In diesem Moment erlangt der Mönch Selbstverwirklichung und versteht, dass Wut in ihm ist; es muss einfach ein externes Objekt treffen, um sie zu provozieren.
Wann immer er danach jemanden trifft, der ihn irritiert oder wütend macht, erinnert er sich: der andere Menschen ist nur ein leeres Boot.
Wut ist in mir.“
Seesterne

Es war einmal ein alter Mann, der jeden Morgen einen Spaziergang am Meeresstrand machte.
Eines Tages sah er einen kleinen Jungen, der vorsichtig etwas aufhob und ins Meer warf. Er rief: “Guten Morgen. was machst Du da?”
Der Junge richtete sich auf und antwortete: “Ich werfe Seesterne ins Meer zurück. Es ist Ebbe, und die Sonne brennt herunter. Wenn ich es nicht tue, dann sterben sie.”
“Aber, junger Mann”, erwiderte der alte Mann, “ist dir eigentlich klar, dass hier Kilometer um Kilometer Strand ist. Und überall liegen Seesterne. Du kannst unmöglich alle retten, das macht doch keinen Sinn.”
Der Junge hörte höflich zu, bückte sich, nahm einen anderen Seestern auf und warf ihn lächelnd ins Meer. “Aber für diesen macht es Sinn!”
Nach der Erzählung “The Star Thrower” von Loren Eiseley (1969)
ZWILLINGE IN DER GEBÄRMUTTER UNTERHALTEN SICH
„Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?“
„Ja, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir stark genug sind für das was uns erwartet.“
„Blödsinn, das gibt es doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt?“
„Das weiß ich auch nicht genau. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen?“
„So ein Unsinn! Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt.
Außerdem geht das Herumlaufen gar nicht, die Nabelschnur ist ja jetzt schon viel zu kurz.“
„Doch es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders.“
„Es ist noch nie einer zurückgekommen von ’nach der Geburt‘. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine Quälerei und dunkel..“
„Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen.“
„Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?“
„Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie.
Ohne sie können wir gar nicht sein!“
„Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht.“
„Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören.
Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt….“
(nach Henry Nouwen)
DIE LÖWEN UND DIE SCHAFE
Auf einer Wiese weidete friedlich eine Herde Schafe. Plötzlich tauchten aus dem umliegenden Wald Löwen auf und warfen sich auf die Herde. Die Schafe hatten keine Chance und es gab viele Opfer. Die Löwen blieben und beraubten die Schafe ihrer früheren Freiheit. Die Schafe litten sehr, denn sie waren vollständig der überlegenen Macht der Löwen ausgeliefert. Die Schafe taten sich zusammen und besprachen ihre Situation. So auf jeden Fall konnte es nicht weitergehen.
Es ergab sich, dass unter den Schafen ein altes und schlaues Schaf war, das folgende Überlegungen anstellte: «Durch die Kraft können wir den Löwen nicht entrinnen; wir können uns nicht in Löwen verwandeln. Aber etwas ist möglich; wir können aus den wilden Löwen zahme Schafe machen. Wir können die Löwen dazu bringen, dass diese ihre eigene Natur vergessen; das ist möglich.» Die anderen Schafe willigten in einen Versuch ein. So begann das inspirierte Schaf mit seiner Botschaft an die blutdürstigen Löwen.
Es rief: «Oh, ihr unverschämten Lügner, ihr, die ihr nichts wisst von der ewigen Verdammnis! Ich besitze die spirituelle Macht, ich bin ein Gesandter Gottes für die Löwen. Ich bin das Licht für das verdunkelte Auge, ich komme, um Gesetze zu erlassen und Befehle zu erteilen. Lasst ab von euren schändlichen Taten! Ihr, die ihr das Böse in euch habt, denkt an das Gute! Wer wild und brutal ist, ist ein Tyrann. Die gerechten Wesen ernähren sich nicht von Fleisch, sondern von Gras. Den Vegetarier hat Gott lieb. Eure spitzen Zähne sind eine Schande für euch. Das Paradies gehört den Schwachen. Es ist schlecht, nach Wohlstand zu trachten; die Armut ist Gott wohlgefälliger als der Reichtum. Anstatt Schafe zu töten, töte dein Selbst und du wirst belohnt werden! Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr euer Selbst nicht vergesst. Schließt eure Augen, schließt eure Ohren, schließt eure Lippen, damit eure Gedanken den höchsten Himmel erreichen können. Diese Weide ist nichts, ist Illusion, gebt euch nicht mit einer Illusion zufrieden!» So sprach das schlaue Schaf.
Und es kam, wie es kommen musste. Die Löwen, ermüdet von ihrem ständigen Kampf, machten sich langsam die Religion der Schafe zu eigen. Sie begannen Gras zu fressen, ihre Zähne wurden langsam stumpf, das schreckliche Leuchten in ihren Augen verschwand; langsam schwand auch der Mut aus ihren Herzen. Sie verloren die Fähigkeit zu herrschen, sie verloren ihr Ansehen, ihre Macht, ihren Wohlstand. Ihre körperliche Kraft schwand dahin, während ihre spirituelle Angst wuchs. Die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem göttlichen Gericht nahm ihnen den Mut. Die Angst produzierte zahllose Krankheiten, die sie vorher nie gekannt hatten. Armut und kleinliches Denken hielten Einzug in die Herde der einst machtvollen Löwen. Die Schafe hatten es geschafft, die Löwen einzuschläfern. Die Löwen nannten diesen Niedergang «Die moralische Kultur».
Sternengeburt
Wenn du nachts schon einmal den Sternenhimmel betrachtet hast, kennst du sicher den „Großen Wagen“. Mitten drin saß einst ein kleiner Stern, von dem ich dir erzählen will.
Dieser kleine Stern leuchtete wunderschön. Er war schon weit gereist durch ’s große All und hatte viele Planeten in den verschiedensten Farben besucht, aber nirgends gefiel es ihm so recht, dass er immer weiter zog, bis er irgendwann , vielleicht war ’s erst gestern, den „Großen Wagen“ traf.
„Oh“, so etwas Wunderschönes hatte er noch nie gesehen, ein Sternenwagen, der am Himmel seine Bahnen zog. Er fragte ihn, ob er ein Stück mitfahren dürfe. Der „Große Wagen“ hatte nichts dagegen, denn es kam selten ein Stern vorbei, der noch frei und ungebunden umherreisen konnte.
So setzte sich der kleine Stern in die Mitte des „Großen Wagens“. Die beiden hatten viel Spaß, gemeinsam über den Himmel zu ziehen. Sie erzählten sich ihre Erlebnisse und der kleine Stern hörte aufmerksam zu, als der „Große Wagen“, von seinen Fahrten, seit unendlichen Zeiten, um die Erde berichtete. Der kleine Stern wurde immer neugieriger und bat den „Großen Wagen“ ihm noch mehr über diese kleine blaue Kugel zu erzählen. Worauf der „Große Wagen“ zu ihm sagte, er solle sich gut festhalten und ruhig sitzen bleiben. Er werde ihm alles zeigen.
Vorsichtig beugte sich der kleine Stern über den Rand des „Großen Wagens“ und blickte zur Erde hinab. Jetzt erst, nach näherem Betrachten erkannte er, durch das leuchtende Blau, die großen Meere, riesige Gebirge mit schneebedeckten Gipfeln und einem Regenbogen in den leuchtendsten Farben, die du dir denken kannst.
Der Kleine Stern war wie verzaubert und dachte bei sich, dort muss ich hin. Er überlegte, wie er es wohl anstellen könne, um auf diese Erde, vielleicht einen dieser schneebedeckten Gipfel , zu gelangen und setzte sich schon zum Sprung in die Tiefe an.
„Halt!“ schrie der „Große Wagen“, „wenn du springst, wirst du verglühen.“
Er hatte nämlich bemerkt, was der kleine Stern sich wünschte. Er sprach zu ihm: „Wenn du auf dieser Erde leben möchtest, dann schlaf ein. Du wirst in deinem Traum verschiedene Klänge hören, folge dem, der dir am besten gefällt. Er wird dich über en Regenbogen sicher auf die Erde geleiten.“
Der Kleine Stern bedankte sich bei seinem Freund, dem „Großen Wagen“, legte sich in ihm nieder und schlief ein. Es geschah , wie der „Große Wagen“ ihm sagte. Er hörte die verschiedene Klänge. er lauschte, in deren Schönheit vertieft und gespannt, welcher von allen wohl sein Klang sei, als er plötzlich aus weiter Ferne ganz zart und leise einen, in unbeschreiblicher weise, lieblicher Klang vernahm. Da wusste er sofort, das war sein Klang.
Er stand auf, ging in die Richtung, aus der er den Klang vernahm. folgte ihm und wurde durch und durch erfüllt von dem Klang, bis er Eins war mit ihm und über den in all seinen Farben leuchtenden Regenbogen auf die Erde glitt. Ganz benommen von diesem Klang- und Farbenrausch fing er an, langsam zu erwachen. Was war geschehen? Wo befand es sich? Ein warmes Gefühl von Geborgenheit machte sich um ihn herum breit. Explosionsartig verspürte er Wachstum, weiche runde Formen wahrzunehmend. Er war nun kein Himmelkörper mehr, sondern ein kleines zartes, weiches Wesen , in einer von gedämpften Licht durchfluteten, es mit warmen Wasser einhüllenden Höhle. In glückseliger Stille schlief es ein.
In den folgenden Tagen und Wochen nahm es zunehmend menschliche Gestalt an. Es fühlte sich sehr wohl, in diesem mit weichen, warmen Wänden ausgestatteten Wasserhöhle. die es sanft hin und her bewegte.
Es entsann sich der schneebedeckten Gipfeln und tiefen Meeren. Wo waren sie geblieben? Wie konnte es aus der Höhle heraus, zu ihnen gelangen? Es wusste, es müssen Monate vergehen. In diese Träumereien versunken und im Wasser schwebend wurde es plötzlich durch erregtes Stimmengewirr aufgeschreckt, beängstigende Gefühle des nicht Willkommenseins durchdrangen den Raum. Die Wände der Höhle zogen sich zusammen, wurden eng, es bekam kaum noch Luft, ein stechender Schmerz schoss durch seinen winzigen Körper. „HILFE“. Seine Lippen gehorchten ihm nicht, einen Laut zu formen. Er wäre wohl auch nicht zu hören gewesen, in der Tiefe dieser mit warmen Wasser gefüllten Höhle.
Aufgeregt schnappte es nach Luft, schubweise kam sie bei ihm an. Plötzlich Stille, es konnte wieder atmen, doch nun machte sich ein Gefühl von unendlicher Traurigkeit breit.
Es spitze die Ohren, vernahm leise, verzweifelte Stimmen. Es ging um ihn! Es hieß, es sollte nicht auf Erden bleiben, man wollte es los werden, wieder zurückschicken. „NEIN!“ Entsetzt packte es. „Das geht doch nicht, ich muss doch noch alles erkunden, auf die schneebedeckten Gipfel gehen, ins tiefe Meer eintauchen! NEIN!, ich will bleiben!“
Erschöpft schlief es ein. So hatte es sich das Leben nicht vorgestellt. Wo waren die leuchtenden Farben, die zarten Klängen das freudige Lachen? Ungewissheit schlich sich ein. Konnte es in der Höhle bleiben?
Tage des Bangen verstrichen, manchmal vernahm es leises Weinen. Es durfte nun doch bleiben.
Monate vergingen, das kleine Wesen wuchs, wurde immer größer, bis es die Höhle mit seinem Körper ausfüllte und kein Platz mehr war, Arme und Beine auszustrecken. Nun war es Zeit, diesen Ort zu verlassen. Aber wie diese Höhle öffnen? Vielleicht kam wieder ein Klang, der ihm den Weg wies? Und so schlief es ein, um den Weg nach außen zu finden.
Unsanft von bebenden Wänden umgeben, erwachte es. Die es umgebende, mit Wasser gefüllte Hülle zerplatzte und das Wasser floss durch ein kleines Licht in der Wand davon. Der Sog des Wassers zog es in die Öffnung, die sich langsam, durch den Druck des Gewichtes vergrößerte. Mühevoll zwang es sich durch einen engen Tunnel hinaus ins Licht, Zwei große Hände nahmen es am Ende des Tunnels in Empfang und hielten es in der Luft. „Ein Mädchen!“ hörte es eine freundliche Stimme rufen.
Es war plötzlich so kalt um sie herum, gleißendes Licht schimmerte durch ihre geschlossenen Lider. Die sie haltenden Hände ergriffen ihre winzigen Füße, hoben sie daran hoch, ihr Körper baumelte in der Luft, nun verspürte sie einen Schlag auf dem Po, ihr Mund öffnete sich, Luft drang brennend in ihre Lungen, sie hörte sich schreien. Scharfe Gerüche drangen in ihre Nase.
Die Menschen um sie herum machten zufriedene Gesichter. Zitternd vor Kälte, dieses ungehörigen Empfangen, legten die , sie nun wieder haltenden Hände, sie sanft, endlich, auf ihrer Mutter Bauch. Warme Hände umfassten ihren kleinen bebenden Körper, strahlende Augen trafen ihren ersten Blick. Erschöpft und verschreckt war sie nun angekommen mitten ins Leben dieser Welt.
Das kleine Mädchen wuchs heran und begann die Welt zu entdecken. Sie fand ihre Freunde draußen in der Natur. Da war der nahe Fluss, der das schwere Mühlrad mit., oft fürchterlichen, Getöse drehte und wegen seiner vielen Arbeit oft nur wenige Zeit für sei hatte; die riesige Weide, die ihre Traurigkeit verstand und eine uralte Eiche, die immer einen Rat wusste.
Sie erinnerte sich noch oft ihres Daseins als kleiner Stern , ihrer Reisen in ferne Galaxien, ihrer Begegnung mit dem „Großen Wagen“, ihrer Reise auf die Erde und der Traurigkeit, die sie schon so früh kennen gelernt hatte. Als sie den großen Menschen von ihren Erlebnissen erzählte, wurde sie der Lüge beschimpft, man schenkte ihr keinen Glauben.
In welcher Welt war sei geboren???
Sie hörte oft Worte, wie „glückliche Kindheit“.
War es Glück, was sie erlebte?
Keiner der Menschen wollte etwas davon wissen . So verschloss sie ihr Glück tief in ihrem Herzen und die Traurigkeit wuchs. Nur manchmal, wenn sie auf ihrer Schaukel saß, kraftvoll die Beine ausstreckend, den Oberkörper weit nach hinten gebeugt mit im Winde wehenden Haar, auf der Schaukel empor schwang und bis in den Himmel flog, war die Traurigkeit kein Thema mehr.
(Ein Märchen aus der Tiefe der Seele geschrieben von Christiane Mehrer)

Der Geizige
Ein Geizhals hatte fünfhunderttausend Dinar angesammelt und freute sich auf ein Jahr angenehmen Lebens, bevor er sich entscheidet, wie er sein Geld am besten anlegt, als plötzlich der Engel des Todes vor ihm erschien, um sein Leben zu nehmen.
Der Mann bettelte und flehte und gebrauchte tausend Argumente, damit ihm erlaubt sei, ein bisschen länger zu leben, aber der Engel war hartnäckig. „Gib mir drei Tage Leben und ich gebe dir die Hälfte meines Vermögens“, flehte der Mann. Der Engel wollte nichts davon hören und begann, an ihm zu zerren. „Gib mir nur einen Tag, bitte ich dich und du kannst alles haben, was ich durch so viel Schweiß und Blut angesammelt habe.“ Der Engel blieb weiter unerbittlich.
Er konnte dem Engel nur ein kleines Zugeständnis abringen — ein paar Momente, um diese Nachricht aufzuschreiben: „Oh, du, wer immer du bist, der du diese Nachricht findest, wenn du genug hast, um davon zu leben, verschwende dein Leben nicht im Ansammeln von Vermögen. Lebe! Meine fünfhunderttausend Dinar konnten mir nicht eine einzige Stunde Leben erkaufen!“
Wenn Millionäre sterben und die Leute fragen: „Was haben sie hinterlassen?“, ist die Antwort selbstverständlich: „Alles.“
Und manchmal: „Sie haben es nicht hinterlassen. Sie wurden davon fortgenommen.“
Anthony de Mello, SJ
Die Frau aus dem Regenbogen
Es war einmal ein Mann, der in seiner Jugend etwas sehr Seltsames erlebt hatte. Niemals hatte er darüber gesprochen, niemandem davon erzählt. Doch immer hatte er dieses Erlebnis in sich getragen und keinen einzigen Augenblick davon vergessen.
An einem lauen Sommerabend saß dieser Mann mit seinem Sohn unter einem Baum, um sich ein wenig auszuruhen. Und an diesem Abend begann er zu erzählen, gerade als die Sonne sich verabschiedete, und die Nacht sanft und warm den Alten und seinen Sohn in ihre Arme nahm: „Unter diesem Baum, mein Junge, da bin ich vor vielen, vielen Jahren auch gesessen, als mir damals etwas Unerklärliches und Geheimnisvolles geschah.“ Sein Sohn blickte ihn erstaunt an. Nie war sein Vater ein großer Erzähler gewesen. Doch nun fuhr er fort: „Es war auch so ein warmer Sommertag wie heute. Ich war noch jung, etwa in deinem Alter. Ich suchte ein wenig Ruhe und ging spazieren, als mich plötzlich ein Regen überraschte, einer von diesen kurzen, aber heftigen Sommerregen. Unter diesem Baum fand ich damals Schutz.
Und nach dem Regen blieb ich noch ein wenig sitzen, um mich von der Sonne wieder wärmen und trocknen zu lassen.“ Er atmete tief durch, schwieg eine Weile und blickte seinem Sohn forschend in die Augen. Dieser erwiderte den Blick seines Vaters offen und aufmerksam und wartete. „Ja“, sprach der Alte weiter, „dann geschah es. Ich weiß nicht ob ich eingeschlafen war oder was auch immer geschehen sein mag, jedenfalls schreckte ich plötzlich auf. Ein unglaublich schöner Regenbogen überspannte den ganzen Himmel. Doch seltsam: das Ende des Regenbogens schien nur einige Meter von mir entfernt zu sein. Ich war verwirrt und wusste nicht, wie mir geschah. Da trat plötzlich aus diesem Rausch der Farben eine Frau auf mich zu.“ Sein Sohn runzelte ein wenig die Stirn. Der Alte nahm dies wohl war, redete aber einfach weiter: „ich weiß, dass das verrückt klingt. Aber glaub mir: Genauso ist es damals geschehen.“
Noch einmal holte er tief Luft. „Diese Frau war ein Traum. Sie war alles, was sich ein Mann bei einer Frau nur wünschen kann, ich meine nicht nur Äußerlichkeiten. Obwohl ich sie ja nie zuvor gesehen hatte, wusste ich das alles sofort. Wirklich seltsam…“ Er schüttelte nachdenklich den Kopf. „Nun ja, wie dem auch sei“, nahm er den Faden wieder auf, „diese Frau aus dem Regenbogen setzte sich neben mich und sprach mit mir. Um ehrlich zu sein: Ich sprach mit ihr. Sie selbst sagte eigentlich nur drei Sätze. Aber ich erzählte und erzählte und konnte gar nicht aufhören. Vielleicht war es die Aufregung, vielleicht meine Unsicherheit, wer weiß? Ich redete von mir und meinen Träumen, von meinen Sorgen und Nöten, von allem möglichen. Später schämte ich mich, weil ich wie ein Wasserfall geredet hatte. Doch ich glaube, sie hat es verstanden. Wohl niemals in meinem Leben habe ich so viel und so lange geredet wie damals.“
Sein Sohn blickte ihn liebevoll an, fühlte sich seinem Vater auf einmal sehr nahe und hätte ihn am liebsten in die Arme genommen. Doch er tat es nicht, sondern fragte: „Diese drei Sätze, Vater, erinnerst du dich noch an sie?“
„Aber sicher“, nickte sein Vater, „ich habe sie nie vergessen. Es waren eigenartige Sätze. Einer lautete: ‚Es liegt in deiner Hand, du bestimmst dein Leben, auch wenn es nicht immer so erscheint.‘“
Nachdenklich blickte er vor sich hin und schwieg. „Und die anderen Sätze?“ fragte sein Sohn weiter. „Ach ja!“ Der Alte schien aus seinem Traum zu erwachen, und es war, als müsse er erst wieder zu sich finden. Doch dann sprach er weiter „der zweite Satz war: ‚Versuche die Menschen zu lieben, auch wenn sie es dir nicht leicht machen werden.‘ Ich glaube, dass ich diesen Satz einigermaßen verstanden habe. Immer habe ich im Grunde versucht, auch so zu leben, obwohl ich heute fürchte, dass ich viel zu selten geliebt habe.“ Wieder lächelte sein Sohn, und dieses mal war er es, der eine Weile nachdenklich vor sich hinblickte. “Der dritte Satz“, fuhr sein Vater fort, „war der seltsamste. Ich habe ihn wohl nie ganz begriffen: ‚Lass es so geschehn, wie es ist, auch wenn du manchmal lieber gegen vieles kämpfen möchtest.‘“ Er schwieg, und es schien, als habe er die Erzählung beendet.
Gedankenverloren folgte der Blick seines Sohnes einem welken Blatt, das im leichten Sommerwind zur Erde schwebte. Schließlich sagte er, „Es lohnt sich, über alle drei Sätze nachzudenken und zu reden, Vater. Mir scheint, du hast sie meistens nur mit dir herumgetragen und nur wenig davon verstanden, wenn ich dich und dein Leben so betrachte.“ Sein Vater blickte ihm aufmerksam ins Gesicht. „Da magst du vielleicht recht haben“, sagte er traurig und fuhr fort: „Weißt du, je älter ich wurde, desto mehr habe ich das auch gefühlt. Doch denke ich, dass nicht jeder dieser drei Sätze so stimmen muss. Man kann darüber auch streiten – obwohl ich es manchmal, tief in mir, anders fühle. Und heute ist es für vieles zu spät, mein Sohn.“ – „Ich weiß nicht, Vater“, sagte der junge Mann. „Oft ist es nur eine Ausrede, wenn jemand so etwas sagt.
Aber wie ging denn die Geschichte mit dieser Frau weiter?“ Jetzt war es der Vater, der seinen Sohn liebevoll anblickte und am liebsten in die Arme genommen hätte. Auch er erzählte stattdessen weiter: „Es war damals sehr spät geworden über meinem vielen Gerede und bereits dunkel, als ich auf einmal nichts mehr zu reden wusste. Da setzte sich diese Frau zu mir und nahm mich in die Arme.“ Der Alte lächelte und seufzte tief. „Und dann war sie sehr zärtlich zu mir. Ich glaube, sie brachte mir die Liebe bei, wie man das zu nennen pflegt. Nie wieder habe ich solch eine Frau erlebt.“ – „ Du meinst körperliche Liebe?“ wollte sein Sohn wissen.
Der Vater nickte: „Ja und nein. Es war mehr als körperliche Liebe, da war so vieles.“ Wieder schwieg er eine ganze Weile, bevor er stockend weitererzählte: „Es ist nicht einfach in Worte zu fassen, was da geschah. Weißt du, es war, als würde ich plötzlich losfliegen, mitten in den Sternenhimmel über uns. Der Mond hob mich empor und nahm mich in sich auf. Und die Sonne gab mir Kraft und zündete etwas in mir an, obwohl sie nicht einmal zu sehen war. Und die Sterne tanzten um mich, und ich flog mitten ins All, ins Herz aller Dinge. Und ich fühlte und erlebte, was ich einfach nicht beschreiben kann. Die Zeit stand still, und dann raste sie wieder an mir vorbei.
Mein Körper schien auseinander zu brechen, und doch fühlte ich mich so fest und sicher in mir wie nie zuvor. Manchmal dachte ich, vor lauter Leidenschaft irre zu werden, und doch war es in mir unheimlich still und friedlich.“ Er schüttelte den Kopf. „Ach, es ist einfach unbeschreiblich gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes, was diese Frau damals mit mir gemacht hat.“
Vater und Sohn blickten sich lange an. Dann sagte der Sohn: „Es war ja nicht nur die Frau, die etwas gemacht hat. Du hast ja auch dazu beigetragen, oder nicht?“
Sie saßen eine ganze Zeit lang schweigend beieinander. Es war still unter dem Baum und in der Nacht, und ein klarer, wunderschöner Sternenhimmel tat sich über ihnen auf. Die beiden Männer hingen ihren Gedanken nach, jeder seinen und doch den gleichen. Irgendwann räusperte sich der Sohn und fragte: „Und was geschah dann noch weiter, Vater?“ Sein Vater hob den Kopf und wieder schien es, als wäre er eben erst aus einer anderen Welt zurückgekehrt. Schließlich antwortete er: „Eigentlich nichts Besonderes. Irgendwann in der Nacht bin ich damals zu mir gekommen. Es hat lange gedauert, bis ich mich und meinen Verstand wieder beisammen hatte. Die Frau war verschwunden und ich habe sie bis heute niemals wieder gesehen.“ Auf einmal schien er dem Weinen nahe. „Weißt du, mein Junge, ich habe sie immer gesucht.
Hier unter diesem Baum, in jedem Regenbogen und in jeder Frau. Aber ich habe sie nie gefunden. Keine Frau war so wie sie, keine hat mir so zugehört, mir solche Sätze gesagt, mich in solche Leidenschaft versetzt. Und glaub‘ mir, ich habe viele Frauen gekannt. Auch deine Mutter, die ich wirklich sehr gern habe, auch sie ist nicht so wie diese Frau.“ Seine Stimme wurde leiser. „Die Frau aus dem Regenbogen….“, lachte er vor sich hin, „ich weiß nicht einmal ihren Namen. Und nie habe ich so richtig begriffen, was sie mir sagen wollte. Vielleicht habe ich deshalb mein ganzes Leben lang im Grund nach ihr gesucht.“
Sein Sohn blickte ihn voller Wärme an. „Ich weiß nicht, Vater“, sagte er. „Vielleicht?“ Er dachte nach, rang nach Worten und fuhr schließlich fort: „Ich glaube, sie hat dir etwas Großes geschenkt: Liebe aus Leib und Seele.“ Er atmete tief die kühler werdende Nachtluft ein. „Ja, und du hast dieses Geschenk nicht weitergegeben, sondern dein Leben lang immer mehr davon gesucht, überall und jederzeit hast du noch mehr von dieser Liebe gesucht.“
Er erhob sich und streckte sich ausgiebig. „Wie wohl jeder Mensch“, sagte er dann weiter, „wir suchen alle nach der Liebe, in jeder Frau und in jedem Mann, auch ich. Und dabei vergessen wir das Wichtigste.“ Der Vater blickte zu seinem Sohn auf, Tränen in den Augen, fassungslos, und murmelte: „Du hast sie verstanden.“ Und noch einmal: „Ja, du hast sie verstanden.“ Und dann sagte er, noch immer unter dem Baum sitzend und zu seinem Sohn aufblickend: „Ich glaube, jetzt fange auch ich an zu verstehen. Komm, mein Junge, hilf deinem Vater nun auch noch beim Aufstehen.“ Der junge Mann reichte seinem Vater die Hand und beide machten sich auf den Heimweg in dieser kühler werdenden Sommernacht. Auf einmal raschelten in dem Baum die Blätter, und der Mond schien durch die Äste genau dorthin, wo die beiden Männer gesessen waren. Weder Vater noch Sohn sprachen noch einmal über die Frau aus dem Regenbogen – aber etwas war zwischen ihnen geschehen, was unauslöschlich war. Beide hatten sich verändert. Auch die Frau des alten Mannes spürte das. Doch sie erfuhr niemals von dem Erlebnis des alten Mannes und von dem Gespräch zwischen Vater und Sohn.
Als der Sommer zur Neige ging, machte der Alte, wie so oft, einen Spaziergang am Nachmittag. Es war warm und roch nach Herbst, und etwas Eigenartiges lag in der Luft. Später regnete es kurz und heftig, und danach verzauberte ein unheimlich schöner Regenbogen den Himmel. Der junge Mann zeigte ihn seiner Mutter und dachte insgeheim an seinen Vater. Still lächelte er vor sich hin und verstand auf einmal noch mehr von der Suche seines Vaters. Wie viele Farben, so fragte er sich in diesem seltsamen Augenblick, wie viele Farben mag wohl die Sehnsucht haben?
Mitten in der Nacht wurde er von seiner Mutter geweckt. Voller Sorge bat sie ihn, nach dem Vater zu suchen, weil er von seinem Spaziergang nicht heimgekehrt war. Sofort machte er sich auf den Weg. Aus irgendeinem Grunde wusste er, wo er seinen Vater finden würde. Und da war er dann auch. Still und friedlich lag er unter seinem Baum, ein glückliches Lächeln in seinem Gesicht. Der Sohn begriff sofort. Er nahm den alten Mann in seine Arme und drückte ihn liebevoll an sich. Und während er bitterlich weinend um seinen toten Vater in den Armen unter diesem Baum saß, rauschte es wieder in den Blättern, und der Mond warf ein mildes Licht auf die beiden. Da huschte in Lächeln über das tränenüberströmte Gesicht des jungen Mannes, und er flüsterte seinem Vater ins Ohr: „Du weißt es nun, nicht wahr? Sie hat es dir gesagt.“
Er drückte ihn ein letztes Mal an sich und war sicher, dass sein Vater die Frau aus dem Regenbogen noch einmal gesehen hatte.
(aus dem Buch „Wieviele Farben hat die Sehnsucht?“ von Heinz Körner)
Drei Wünsche
Ein junges Ehepaar lebte recht vergnügt und glücklich beisammen und hatte den einzigen Fehler, der in jeder menschlichen Brust daheim ist: wenn man ’s gut hat, hätt man ’s gerne besser. Aus diesem Fehler entstehen so viele törichte Wünsche, woran es unserm Hans und Liese auch nicht fehlte. Bald wünschten sie des Schulzes Acker, bald des Löwenwirts Geld, bald des Meyers Haus und Hof und Vieh, bald einmal hunderttausend Millionen bayrische Taler kurzweg.
Eines Abends aber, als sie friedlich am Ofen saßen und Nüsse aufklopften und schon ein tiefes Loch in den Stein hinein geklopft hatten, kam durch die Kammertür ein weißes Weiblein herein, nicht mehr als eine Elle lang, aber wunderschön von Gestalt und Angesicht, und die ganze Stube war voll Rosenduft. Das Licht löschte aus, aber ein Schimmer wie Morgenrot, wenn die Sonne nicht mehr fern ist, strahlte von dem Weiblein aus und überzog alle Wände. Über so etwas kann man nun doch ein wenig erschrecken, so schön es aussehen mag. Aber unser gutes Ehepaar erholte sich doch bald wieder, als das Fräulein mit wundersüßer, silberreiner Stimme sprach: „Ich bin eure Freundin, die Bergfei Anna Fritze, die im kristallenen Schloss mitten in den Bergen wohnt, mit unsichtbarer Hand Gold in den Rheinsand streut und über siebenhundert dienstbare Geister gebietet. Drei Wünsche dürft ihr tun; drei Wünsche sollen erfüllt werden.“
Hans drückte den Ellenbogen an den Arm seiner Frau, als ob er sagen wollte: Das lautet nicht übel. Die Frau war aber schon im Begriff, den Mund zu öffnen und etwas von ein paar Dutzend goldgestickten Kappen, seidenen Halstüchern und dergleichen zur Sprache zu bringen, als die Bergfei sie mit aufgehobenen Zeigefinger warnte: „Acht Tage lang“, sagte sie, „habt ihr Zeit. Bedenkt euch wohl und übereilt euch nicht.“.
Das ist kein Fehler bedachte der Mann und legte seiner Frau die Hand auf den Mund. Das Bergfräulein aber verschwand. Die Lampe brannte wie vorher, und statt des Rosenduftes zog wieder wie eine Wolke am Himmel der Öldampf durch die Stube. So glücklich nun unsere guten Leute in der Hoffnung schon zum voraus waren und keinen Stern mehr am Himmel sahen, sondern lauter Bassgeigen, so waren sie doch recht übel dran, weil sie vor lauter Wunsch nicht wussten, was sie wünschen wollten, und nicht einmal das Herz hatten, recht daran zu denken oder davon zu sprechen, aus Furcht, es möchte für gewünscht passieren, ehe sie genug überlegt hätten. „Nun“, sagte die Frau, „wir haben ja noch Zeit bis Freitag.“
Des andern Abends, während die Grundbirn zum Nachtessen in der Pfanne prasselten, standen beide, Mann und Frau, vergnügt an dem Feuer beisammen, sahen zu, wie die kleinen Feuerfünklein an der russigen Pfanne hin und her züngelten, bald angingen, bald auslöschten, und waren, ohne ein Wort zu reden, vertieft in ihrem zukünftigen Glück. Als aber die gerösteten Grundbirn aus der Pfanne auf das Plättchen anrichteten und ihr Geruch lieblich in die Nase stieg: „Wenn wir jetzt ein gebratenes Würstlein dazu hätten“, sagte sie in aller Unschuld und ohne an etwas zu denken, und – o weh, da war der erste Wunsch getan. – Schnell wie ein Blitz kommt und vergeht, kam es wieder wie Morgenrot und Rosenduft untereinander durch das Kamin herab, und auf den Grundbirn lag die schönste Bratwurst.- Wie gewünscht, so geschehen. – Wer sollte sich über einen solchen Wunsch und sein Erfüllung nicht ärgern? Welcher Mann über solche Unvorsichtigkeit seiner Frau nicht unwillig werden?
„Wenn dir doch nur die Wurst an der Nase angewachsen wäre“, sprach er in der ersten Überraschung, auch in aller Unschuld und ohne an etwas anders zu denken – und wie gewünscht, so geschehen. Kaum war letzteres gesprochen, so saß die Wurst auf der Nase des guten Weibes fest, wie angewachsen im Mutterleib, und hing zu beiden Seiten herab wie ein Husarenschnauzbart.
Nu war die Not der armen Eheleute erst recht groß. Zwei Wünsche waren getan und vorüber, und noch waren sie um keinen Heller und um kein Weizenkorn, sondern nur um eine böse Bratwurst reicher. Noch war ein Wunsch zwar übrig. Aber was half nun aller Reichtum und alles Glück zu einer solchen Nasenzierat der Hausfrau? Wollten sie wohl oder übel, so mussten sie die Bergfei bitten, mit unsichtbarer Hand Barbiersdienste zu leisten und Frau Liese wieder von der vermaledeiten Wurst zu befreien.
Wie gebeten, so geschehen, und so war der dritte Wunsch auch vorüber, und die armen Eheleute sahen einander an, waren der nämliche Hans und die nämliche Liese nachher wie vorher, und die schöne Bergfei kam niemals wieder.
MERKE:
Wenn dir einmal die Bergfei also kommen sollte, so sei nicht geizig, sondern wünsche
NUMERO EINS : Verstand, dass du wissen mögest, was du NUMERO ZWEI wünschen sollest, um glücklich zu werden.
Und weil es leicht möglich wäre, dass du alsdann etwas wähltest, was ein törichter Mensch nicht hoch anschlägt, so bitte noch NUMERO DREI: um beständige Zufriedenheit und keine Reue.
Oder so:
Alle Gelegenheit, glücklich zu werden, hilft nichts, wer den Verstand nicht hat, sie zu benutzen.
– Johann Peter Hebel
…ich wünsche uns allen von Herzen die Gelegenheit, sei sie auch nur im kleinsten, glücklich zu werden!
– LEONYCE
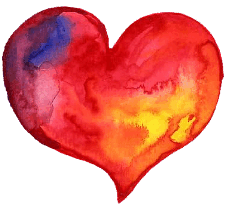
„DAS SCHÖNE HERZ“
Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, dass er das
schönste Herz im ganzen Tal habe.
Eine große Menschenmenge versammelte sich und bewunderten sein Herz, denn es war perfekt.
Es gab keinen Fleck oder Fehler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm Recht, es war wirklich das schönste Herz, das sie je gesehen hatten.
Der junge Mann war sehr stolz und prahlte lauter über sein schönes Herz.
Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und sagte: „Nun, dein Herz ist nicht annähernd so schön wie meines.“
Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des alten Mannes an. Es schlug kräftig, aber war voller Narben, es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt wurden.
Aber sie passten nicht richtig, und es gab einige ausgefranste Ecken. Genauer, an einigen –Stellen waren tiefe Furchen, wo ganze Teile fehlten.
Die Leute starrten ihn an: Wie kann er behaupten, sein Herz sei schöner, dachten sie?
Der junge Mann schaute auf das Herz des alten Mannes, sah dessen Zustand und lachte: „Du musst scherzen“, sagte er „Dein Herz mit meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen.“
„Ja“, sagte der alte Mann, „Deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit Dir tauschen. Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihnen, und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzen, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht genau sind, habe ich einige raue Kanten, die ich sehr schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten
Manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der andere ein Stück seines Herzens zurückgegeben hat. Das sind die leeren Furchen.
Liebe geben heißt manchmal auch ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Furchen schmerzhaft sind, bleiben sie offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde.
Und ich hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen werden.
Erkennst Du jetzt, was wahre Schönheit ist?“
Der junge Mann stand still da und Tränen rannen über seine Wangen.
Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten jungen Herzen und schönen Herzen und riss ein Stück heraus.
Er bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Der alte Mann nahm das Angebot an, setzte es in sein Herz.
Er nahm dann ein Stück seines alten vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde des jungen Mannes.
Es passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder hatte.
Der junge Mann sah sein Herz an, nicht mehr perfekt, aber schöner als je zuvor, denn es spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fließen.
Sie umarmten sich und gingen weg, Seite an Seite.
Autor unbekannt – eingesandt von LEONYCE
Der Dieb und der Zen-Meister
Eines Tages drang ein Dieb in die Hütte des Zen-Meisters Shichiri Kojun ein:
Geld her oder ich werde dich töten!, drohte er.
Kojun erwiderte ruhig:
Mein Geld ist dort drüben in der Schublade. Nimm es dir, aber vielleicht bist du so nett und lässt mir noch ein klein wenig übrig, da ich morgen noch etwas Reis einkaufen möchte.
Der Dieb war zwar sehr erstaunt, nahm sich dann aber doch fast das ganze Geld. Als er schon an der Tür war, sagte Kojun:
Wenn man etwas erhalten hat, sollte man sich auch dafür bedanken.
Danke, erwiderte der Dieb kopfschüttelnd und verschwand.
Wenig später wurde der Mann bei einem anderen Einbruch verhaftet, und er gestand, unter anderem auch den Zen-Meister bestohlen zu haben, der daraufhin zur Polizeiwache gerufen wurde.
Er hat auch euer Geld gestohlen, nicht wahr?, fragte der Polizist.
Oh nein, er hat mir nichts gestohlen. Ich gab ihm das Geld, und er bedankte sich dafür, sagte Kojun. Als der Mann seine wegen der anderen Vergehen gegen ihn verhängte Strafe verbüßt hatte, kam er zu Zen-Meister Kojun und bat darum, sein Schüler werden zu dürfen.
Der Einbrecher und der Meister
Der Einbrecher brach eines Nachts beim Meister ein, der natürlich nichts besaß, was er hätte klauen können. Der Meister war aber wach und empfing den Dieb mit den Worten: „Es tut mir so leid, dass ich nichts für dich habe. Hättest du dich doch angekündigt, dann hätte ich etwas besorgt. Aber komm, wir gehen gemeinsam durchs Haus, vielleicht findest du ja doch etwas.“
Der Einbrecher war völlig verwirrt, so ein Mensch war ihm noch nie begegnet und er wollte so schnell wie möglich dieses Haus wieder verlassen.
Er sagte zum Meister: “ Dir ist scheinbar nicht klar, dass ich ein Dieb bin, ein Verbrecher.“ „Das ist ok“, antwortete der Meister, „jeder hat einen Beruf und muss schauen, wie er über die Runden kommt. Übe deinen Beruf gut aus, aber versprich mir eins, wenn du wieder irgendwo einbrichst, sei dabei bewusst.“
Der Einbrecher verstand den Meister nicht. Aber in der nächsten Nacht beim nächsten Einbruch, versuchte er ganz bewusst zu sein. Doch zu seinem Schreck bemerkte er, dass er dann nicht einbrechen konnte, weil er daran dachte, was er den armen Leuten wegnehmen würde und plötzlich Mitleid bekam.
Er lief zurück zum Meister und sagte: “ Du hast mir meinen Beruf ruiniert, ich kann nicht mehr einbrechen, wenn ich bewusst bin. Jetzt musst du mich als Schüler annehmen und mir zeigen, wie du zu dem geworden bist, was du bist.“
Chinesische Legende von einer Frau, deren Sohn starb
Es gibt eine alte chinesische Legende von einer Frau, deren Sohn starb.
In ihrem Kummer ging sie zu einem Heiligen Mann und sagte: „Welche Gebete und Beschwörungen kennst du, um meinen Sohn wieder zum Leben zu erwecken?“
Er sagte zu ihr: „Bring mir einen Senfsamen aus einem Haus, das niemals Leid kennengelernt hat. Damit werden wir den Kummer aus deinem Leben vertreiben.“
Die Frau begab sich auf die Suche nach dem Zauber-Senfkorn. Sie kam an ein prächtiges Haus, klopfte an die Tür, und sagte: Ich suche ein Haus, das niemals Leid erfahren hat; ist hier der richtige Ort? Es wäre sehr wichtig für mich.“ Sie sagten zu ihr: „Da bist du an den falschen Ort gekommen“, und sie zählten all das Unglück auf, das sich jüngst ereignet hatte.
Die Frau sagte zu sich selbst: Wer wohl kann diesen armen unglücklichen Menschen besser helfen als ich, die ich selber so tief im Unglück bin?“ Sie blieb und tröstete sie; dann suchte sie weiter ein Haus ohne Leid. Aber wo immer sie sich hinwandte, in Hütten, Palästen, überall begegnete ihr das Leid. Schließlich beschäftigte sie sich so ausschließlich mit dem Leid anderer Leute, dass sie ganz die Suche nach dem Zauber-Senfkorn vergaß, ohne dass ihr bewusst wurde, dass sie auf diese Weise tatsächlich den Schmerz aus ihrem Leben verbannt hatte.
AUS: „Wenn guten Menschen Böses widerfährt“ von Harold Kushner
– eingesandt von LEONYCE
Lebensbürde
Zu einer Zeit, als die Menschen sich wieder einmal allzusehr über die Bürde beklagten die sie durchs Leben zu tragen hätten, sprach Gott zu Ihnen.
Er rief sie zu einem großen freien Platz, in dessen Mitte jeder sein Lebensbündel ablegen sollte. Die Menschen taten, wie ihnen geheißen wurde.
Dann sprach Gott wieder zu ihnen.
Ein Jeder solle sich nun aus dem Berg von Bündeln ein neues heraussuchen, das ihm erträglicher schien. Es gab ein großes Durcheinander auf dem Platz. Die Menschen sahen sich die verschiedenen Bündel an, denn jeder wünschte sich eine leichtere Bürde. Und so geschah es, dass nach einiger Zeit alle mit einem Bündel zurückkehrten und der Platz wieder leer war.
Seltsam war jedoch, dass jeder sich letztlich sein eigenes Bündel wieder genommen hatte.
Das Wunder der Perle

Man erzählt sich die Geschichte einer Perle hier am Strand.
Sie entstand in jener Muschel durch ein grobes Körnchen Sand.
Es drang ein in ihre Mitte und die Muschel wehrte sich.
Doch sie musste damit leben und sie klagte: Warum ich?
Eine Perle wächst ins Leben, sie entsteht durch tiefen Schmerz.
Und die Muschel glaubt zu sterben, Wut und Trauer füllt ihr Herz.
Sie beginnt es zu ertragen, zu ummanteln dieses Korn.
Nach und nach verstummt ihr Klagen und ihr ohnmächtiger Zorn.
Viele Jahre sind vergangen. Tag für Tag am Meeresgrund
schließt und öffnet sich die Muschel. Jetzt fühlt sie sich kerngesund.
Ihre Perle wird geboren. Glitzert nun im Sonnenlicht.
Alle Schmerzen sind vergessen, jenes Wunder jedoch nicht.
Jede Perle lehrt uns beten, hilft vertrauen und verstehn,
denn der Schöpfer aller Dinge hat auch deinen Schmerz gesehn.
Nun wächst Glaube, Hoffnung, Liebe, sogar Freude tief im Leid.
So entsteht auch deine Perle, sein Geschenk für alle Zeit.
(von Sören Kahl)
Das verrückte Königreich

Ein mächtiger Zauberer, der ein Königreich zerstören wollte, schüttete einen Zaubertrank in den Brunnen, aus dem alle Einwohner tranken. Wer von diesem Wasser trank, würde verrückt werden.
Am folgenden Morgen trank die ganze Bevölkerung davon, und alle wurden verrückt außer dem König, der einen eigenen Brunnen für sich und seine Familie besaß, zu dem der Zauberer keinen Zugang hatte. Besorgt versuchte er die Bevölkerung unter Kontrolle zu bringen, indem er eine Reihe von Sicherheits- und Gesundheitmaßnahmen erließ. Doch die Polizisten und Inspektoren hatten von dem vergifteten Wasser getrunken, hielten die Beschlüsse des Königs für absurd und beschlossen, sie keinesfalls zu befolgen.
Als die Bevölkerung von den königlichen Verordnungen hörte, glaubte sie, der Herrscher sei verrückt geworden und würde nunmehr sinnloses Zeug schreiben. Sie begaben sich unter lautem Geschrei zur Burg und verlangten seinen Rücktritt.
Verzweifelt willigte der König ein, den Thron zu verlassen, doch die Königin hinderte ihn daran und sagte: “Lass uns zum Brunnen gehen und auch daraus trinken. Dann sind wir genauso wie sie.”
So geschah es: Der König und die Königin tranken vom Wasser der Verrücktheit und fingen sogleich an, sinnlose Dinge zu sagen. Nun bereuten die Untertanen ihr Ansinnen. Jetzt, da der König so viel Weisheit zeigte, könne man ihn doch weiter das Land regieren lassen.
Das Leben in diesem Land verlief ohne Zwischenfälle, wenn es auch anders war als das der Nachbarvölker. Und der König regierte bis ans Ende seiner Tage.
(Paulo Coelho – Veronika beschließt zu sterben)
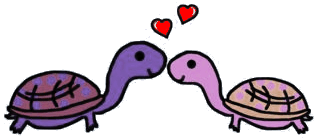
Der Mann, der nicht an die Liebe glaubte
Ich möchte ihnen eine sehr alte Geschichte über den Mann erzählen, der nicht an die Liebe glaubte. Er war ein ganz normaler Mann, genau wie sie und ich, doch was diesen Mann besonders machte, war seine Denkweise.
Er dachte, dass Liebe nicht existiert.
Natürlich hatte er viel Erfahrung in dem Versuch, Liebe zu finden, und er hatte Menschen in seiner Umgebung beobachtet. Einen großen Teil seines Lebens hatte er mit der Suche nach Liebe verbracht, nur um zu dem Schluss zu kommen, dass Liebe nicht existiert.
Wo immer dieser Mann hinging, erzählte er den Menschen, das die Liebe nichts anderes ist als eine Erfindung der Dichter und Poeten, eine Erfindung der Religionen, um den schwachen Geist der Menschen zu manipulieren, um Kontrolle über die Menschen zu erlangen und sie zu Gläubigen zu machen. Er sagte, dass die Liebe nicht wirklich existiere und das dies der Grund sei, warum kein Mensch jemals Liebe finden könne, selbst wenn er danach suche.
Dieser Mann war von hoher Intelligenz und sehr überzeugend. Er hatte viele Bücher gelesen, hatte die besten Universitäten besucht und war ein angesehener Gelehrter geworden. Er konnte jederzeit eine öffentliche Rede halten, vor jedem erdenklichen Publikum und seine Logik war absolut einleuchtend. Er sagte, das Liebe genau wie eine Droge ist, das sie ein Hochgefühl vermittelt und gleichzeitig ein starkes Bedürfnis nach sich selbst entstehen lässt. Sie können äußerst süchtig nach Liebe werden, doch was passiert, wenn sie nicht die tägliche Dosis Liebe bekommen? Genau wie bei einer Droge, brauchen sie dann jeden Tag eine bestimmte Dosis.
Er sagte oft, das die meisten Beziehungen zwischen Liebenden mit der Beziehung zwischen einem Drogensüchtigen und demjenigen vergleichbar sind, der die Droge bereitstellt. Derjenige, der das größere Bedürfnis danach hat, ist dem Drogensüchtigen vergleichbar. Derjenige, dessen Bedürfnis geringer ist, spielt die Rolle dessen, der die Droge zur Verfügung stellt.
Er ist derjenige, der die Beziehung beherrscht. Sie können diese Dynamik deutlich erkennen, da es normalerweise in jeder Beziehung einen Partner gibt, der mehr liebt, und einen, der nicht oder weniger liebt und nur denjenigen ausnutzt, der sein Herz herschenkt. Sie können sehen, auf welche Art die beiden einander manipulieren, ihre Aktionen und Reaktionen, und sie verhalten sich genauso wie der Drogendealer und der Drogensüchtige.
Der Drogensüchtige, derjenige, der das größere Bedürfnis hat, lebt in ständiger Angst davor, das er vielleicht nicht in der Lage sein wird, die nächste Dosis Liebe, also die Droge, zu bekommen.
Er denkt: was mache ich nur, wenn sie mich verlässt?. Diese Angst macht den Drogensüchtigen mehr besitzergreifend. Das gehört mir! Er wird eifersüchtig und fordernd, weil er Angst davor hat, nicht die nächste Dosis zu bekommen. Der Versorger kann denjenigen, der die Droge braucht, kontrollieren und manipulieren, indem er ihm eine größere oder kleinere Dosis gibt, oder auch gar keine. Derjenige mit dem größeren Bedürfnis ordnet sich vollständig unter und wird alles tun, was er kann, um zu verhindern, das er verlassen wird.
Der Mann fuhr fort, allen zu erklären, warum Liebe nicht existiert.
Was die Menschen Liebe nennen, ist nichts als eine Angstbeziehung, die auf Kontrolle basiert. Wo ist der Respekt voreinander? Wo ist die Liebe, die sie zu spüren behaupten?
Diese Liebe existiert nicht. Junge Paare, die vor den Vertretern Gottes auf Erden stehen, vor ihren Familien und Freunden, geben sich gegenseitig eine Menge Versprechungen: für immer zusammenzuleben, einander zu lieben und zu respektieren, füreinander da zu sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie schwören einander zu lieben und zu ehren, und machen ein Versprechen nach dem anderen. Das Erstaunliche daran ist, das sie diese Versprechen wirklich glauben. Doch nach der Hochzeit, eine Woche später, einen Monat später, ein paar Monate später – kann man sehen, das keines dieser Versprechen eingehalten wird.
Was man finden wird, ist ein Krieg um die Macht, darum, wer wen manipuliert. Wer wird der Versorger und wer der Süchtige sein? Man wird feststellen, das der Respekt, den sie einander geschworen haben, nach ein paar Monaten verschwunden ist. Man kann die Ablehnung spüren, das emotionale Gift, wie sie einander weh tun, langsam aber sicher, und wie dieser Schmerz wächst, bis sie nicht mehr wissen, wann die Liebe aufgehört hat.
Sie bleiben zusammen, weil sie Angst davor haben, allein zu sein, Angst vor der Meinung anderer und davor, verurteilt zu werden, und auch Angst vor ihren eigenen Urteilen und Meinungen. Doch – wo ist die Liebe?
Der Mann behauptete, das er viele alte Paare gesehen hatte, die dreißig, vierzig, fünfzig Jahre zusammengelebt hatten und stolz darauf waren. Doch wenn sie über ihre Beziehung sprachen, sagten sie in der Regel: Wir haben die Ehe überlebt.
Das heißt, das einer von ihnen sich dem andren untergeordnet hatte. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten sie aufgegeben und beschlossen, das Leiden zu ertragen. Derjenige mit dem stärkeren Willen und geringerem Bedürfnis hatte den Krieg gewonnen, doch wo ist die Flamme, die sie Liebe nennen?
Sie behandeln einander wie einen Besitz; Sie ist mein. Er ist mein.
Der Mann sprach immer weiter über all die Gründe, warum er glaubte, das die Liebe nicht existiert, und er sagte den anderen: Ich habe alle diese Sachen bereits selber erlebt. Ich werde nie mehr jemandem erlauben, im Namen der Liebe meinen Geist zu manipulieren und mein Leben zu beherrschen. Seine Argumente waren sehr einleuchtend und mit seinen Worten überzeugte er viele Menschen. Es gibt keine Liebe.
Dann ging dieser Mann eines Tages durch einen Park, und auf einer Bank saß eine schöne Frau die weinte. Als er ihre Tränen sah, überkam ihn die Neugier. Er setzte sich neben sie und fragte, ob er ihr helfen könne und warum sie weine.
Sie können sich seine Überraschung vorstellen, als sie sagte, dass sie weine, weil es in Wahrheit keine Liebe gebe. Das ist erstaunlich – eine Frau, die glaubt, das Liebe nicht existiert! Natürlich wollte er mehr über sie erfahren.
Warum sagen sie, das es keine Liebe gibt? – fragte er
Nun, das ist eine lange Geschichte, antwortete sie. Ich habe geheiratet, als ich noch sehr jung war, mit all der Liebe, all diesen Illusionen, voller Hoffnung, das ich mein Leben mit diesem Mann verbringen würde.
Wir schworen einander treu zu sein, uns Respekt und Ehre entgegenzubringen und wir gründeten eine Familie. Doch bald veränderte sich alles. Ich war die hingebungsvolle Ehefrau, die die Kinder und den Haushalt versorgte. Mein Mann fuhr fort, sich seiner Karriere zu widmen und sein Erfolg und sein Image in der Außenwelt waren ihm wichtiger als unsere Familie. Er verlor seinen Respekt vor mir und ich verlor meinen Respekt vor ihm. Wir verletzten einander, und dann kam der Moment, wo ich entdeckte, das ich ihn nicht liebte, und er mich auch nicht.
Aber die Kinder brauchen einen Vater und das war meine Entschuldigung, in der Beziehung zu bleiben und alles zu tun, was mir möglich war, um ihn zu unterstützen. Heute sind die Kinder erwachsen und haben das Haus verlassen. Jetzt habe ich keine Entschuldigung mehr, bei ihm zu bleiben. Zwischen uns gibt es keinen Respekt , keine Herzlichkeit. Ich weiß, dass es selbst dann, wenn ich einen anderen Mann finde, das Gleiche sein wird, weil die Liebe nicht existiert. Es ist sinnlos, nach etwas zu suchen, das es nicht gibt. Das ist der Grund, warum ich weine.
Da er die Frau sehr gut verstand, nahm er sie in die Arme und sagte: Sie haben Recht, Liebe existiert nicht. Wir suchen nach Liebe, wir öffnen unser Herz und wir werden verletzbar, nur um Egoismus und Selbstsucht zu finden. Das tut uns weh, auch wenn wir glauben, das es uns nichts anhaben kann. Es spielt keine Rolle, wie viele Beziehungen wir haben, es passiert wieder und wieder dasselbe. Warum also noch länger nach der Liebe suchen?
Sie waren einander so ähnlich und sie wurden die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Es war eine wunderbare Beziehung. Sie respektierten einander und nie machte einer den anderen schlecht. Mit jedem Schritt, den sie gemeinsam unternahmen, wuchs ihr Glück. Es gab weder Neid noch Eifersucht, keine Kontrollversuche, keinerlei Besitzergreifung. Die Beziehung wurde immer besser. Sie liebten es, zusammen zu sein, denn sie hatten viel Spaß miteinander. Wenn sie nicht zusammen waren, vermissten sie einander.
Eines Tages, als der Mann auf Reisen war, kam ihm ein Gedanke, er dachte: Hmm..vielleicht ist es Liebe, was ich für sie empfinde. Doch dieses Gefühl ist so anders als alles, was ich je zuvor empfunden habe. Es ist nicht so, wie die Dichter es beschreiben, es ist nicht so, wie die Religion behauptet, denn ich bin nicht für sie verantwortlich. Ich nehme ihr nichts weg. Ich verspüre nicht das Bedürfnis, ihr die Schuld an meinen Problemen zu geben oder sie mit meinen Dramen zu belästigen. Wir haben so viel Spaß miteinander, wir genießen die Gegenwart des anderen. Ich respektiere die Art wie sie denkt, die Art, wie sie fühlt. Sie bringt mich nicht in Verlegenheit, sie stört mich nicht im Geringsten. Ich verspüre keine Eifersucht, wenn sie mit anderen Menschen zusammen ist, ich verspüre keinen Neid, wenn sie erfolgreich ist. Vielleicht existiert die Liebe wirklich, doch ist sie ganz anders, als jeder glaubt.
Er konnte kaum abwarten, nach Hause zurückzugehen und ihr von seinen verrückten Gedanken zu erzählen. Sobald er zu sprechen anfing, sagte sie: Ich weiß genau was du meinst. Ich habe schon vor einiger Zeit den gleichen Gedanken gehabt, doch wollte ich dir nichts davon erzählen, weil ich weiß, das du nicht an die Liebe glaubst. Vielleicht gibt es die Liebe wirklich, doch ist sie nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben.
Sie beschlossen Liebende zu werden und zusammenzuleben, und es war erstaunlich, das sich an ihrer Beziehung nichts änderte. Sie respektierten einander nach wie vor, sie unterstützten einander weiterhin, und die Liebe wuchs immer mehr. Selbst die einfachsten Dinge ließen ihre Herzen vor Freude jubeln, weil sie so glücklich waren.
Das Herz des Mannes war so sehr von der Liebe erfüllt, die er empfand, das eines Nachts ein großes Wunder geschah. Es schaute zu den Sternen empor und fand den schönsten von allen, und seine Liebe war so groß, das der Stern vom Himmel herunterkam und kurz danach in seinen Händen lag.
Dann geschah ein zweites Wunder: Seine Seele verschmolz mit diesem Stern. Er war überaus glücklich und konnte es kaum erwarten, zu der Frau zu gehen, um ihr seine Liebe zu beweisen. Doch sobald er ihr den Stern übergeben hatte, spürte sie einen Moment des Zweifels. Seine Liebe war so überwältigend, und in diesem Augenblick fiel ihr der Stern aus den Händen und zerbrach in Millionen kleiner Stücke.
Heute geht ein alter Mann durch die Welt, der schwört, das die Liebe nicht existiert. Und es gibt eine schöne alte Frau, die zu Hause auf einen Mann wartet und eine Träne um das Paradies vergießt, das sie einst in ihren Händen gehalten hat. Dies ist die Geschichte des Mannes, der nicht an die Liebe glaubte.
Wer von den beiden beginn den Fehler?
Möchten sie raten, was falsch gelaufen ist? Der Fehler lag auf Seiten des Mannes, der dachte, er könnte der Frau sein Glück geben. Der Stern war sein Glück und sein Fehler bestand darin, dieses Glück in die Hände der Frau zu legen. Glück kommt nie von außen. Er war glücklich aufgrund der Liebe, die aus seinem Herzen strömte, sie war glücklich aufgrund der Liebe, die aus ihrem Herzen strömte. Doch sobald er sie für sein Glück verantwortlich machte, zerbrach sie den Stern, da sie nicht für sein Glück verantwortlich sein konnte.
Unabhängig davon, wie sehr die Frau ihn liebte, hätte sie ihn nie glücklich machen können, da sie nie wissen konnte, was in seinem Kopf vorging. Es war ihr unmöglich zu wissen, was er erwartete, da sie seine Träume nicht kennen konnte.
Wenn sie ihr Glück nehmen und es in die Hände eines andere Menschen legen, wird es früher oder später zerbrechen. Wenn sie ihr Glück einem anderen geben, kann dieser es ihnen jederzeit wegnehmen. Da also Glück nur aus ihrem eigenen Inneren kommen kann und das Ergebnis ihrer Liebe ist, sind sie allein dafür verantwortlich. Wir können nie einen anderen Menschen für unser eigenes Glück verantwortlich machen, doch wenn wir in die Kirche gehen, um uns zu vermählen, tauschen wir als Erstes Ringe aus. Wir legen jeweils unseren Stern in die Hände des anderen in der Erwartung, das er uns glücklich macht und wir ihn.
Es spielt keine Rolle, wie sehr sie jemanden lieben – sie werden nie so sein – wie ihr Partner es sich wünscht.
Das ist der Fehler, den die meisten Menschen gleich am Anfang begehen. Wir machen unser Glück von einem Partner abhängig, doch das funktioniert nicht. Wir geben alle diese Versprechen, die wir nicht halten können, und programmieren all unsere Versagen.
Don Miguel Ruiz – Vollendung in Liebe

Ein Brief an Gott
Eingesandt von einer Mutter in der Nähe von Houston / USA
Letzen Monat ist unsere 14 Jahre alte Hündin, Abbey, gestorben. Am Tag nach ihrem Tod weinte meine 4 Jahre alte Tochter Meredith und sprach davon, wie sehr sie Abbey vermisste… Sie fragte, ob wir Gott einen Brief schreiben könnten, damit Gott Abbey erkennen könne, wenn sie in den Himmel käme. Ich sagte, dass wir das könnten, und so diktierte sie mir diese Worte:
„Lieber Gott, Kannst Du bitte auf meine Hündin aufpassen? Sie ist gestern gestorben und ist bei Dir im Himmel. Ich vermisse sie sehr. Ich freue mich, dass ich sie als meine Hündin haben durfte, auch wenn sie krank geworden ist.
Ich hoffe, dass Du mit ihr spielen wirst… Sie mag es, mit Bällen zu spielen und zu schwimmen. Ich sende Dir ein Photo von ihr, damit Du, sobald Du sie siehst, weißt, dass sie meine Hündin ist. Ich vermisse sie wirklich.
In Liebe, Meredith“
Wir packten den Brief mit einem Photo von Abbey in einen Umschlag und adressierten ihn an Gott / Himmel. Wir schrieben unsere Absenderadresse darauf. Dann klebte Meredith mehrere Briefmarken auf die Vorderseite des Umschlages, denn sie sagte, dass es für den Weg in den Himmel viele Briefmarken brauche. Diesen Nachmittag warfen wir den Brief in den Briefkasten bei der Post. Ein paar Tage später fragte sie mich, ob Gott wohl den Brief erhalten hätte. Ich sagte ihr, dass ich dachte, er hätte.
Gestern lag ein Päckchen in goldenem Papier auf unserer Veranda, adressiert an “Für Meredith”.
Meredith hat es geöffnet. Darin verpackt war ein Buch von Mr Rogers, das hieß: “Wenn ein Haustier stirbt..”. An der Innenseite der Buchhülle klebte der Brief, den wir Gott geschrieben hatten. Auf der gegenüberliegenden Seite war das Bild mit Abbey und Meredith und diese Notiz:
Liebe Meredith,
Abbey ist sicher im Himmel angekommen. Das Photo hat geholfen. Ich habe sie sofort erkannt. Abbey ist nicht mehr krank. Ihre Seele ist bei mir genau so, wie sie in Deinem Herzen bleibt. Abbey hat es geliebt, Dein Hund zu sein. Weil wir unsere Körper im Himmel nicht brauche, habe ich keine Taschen, um Dein Bild darin zu verwahren, darum sende ich es Dir in diesem kleinen Buch zurück, das Du behalten kannst und womit Du dich an Abbey erinnern kannst.
Vielen Dank für den wunderbaren Brief und danke an Deine Mutter, die Dir geholfen hat, ihn zu schreiben und ihn mir zu schicken. Was für eine wundervolle Mutter Du hast. Ich habe sie extra für Dich ausgesucht. Ich sende Dir jeden Tag meinen Segen und denk daran, dass ich Dich sehr liebe. Übrigens, Du findest mich ganz einfach, ich bin überall, wo Liebe ist.
In Liebe,
Gott
Der Postbeamte wurde nie gefunden…
Der Esel im Brunnen

Eines Tages fiel der Esel eines Bauern in einen Brunnen.
Das Tier schrie stundenlang kläglich, als der Bauer herauszufinden suchte was zu tun ist. Schließlich entschied er das das Tier alt ist, und der Brunnen muss sowieso abgedeckt werden; es war es ihm nicht wert den Esel rauszuholen.
Er lud alle seine Nachbarn ein um ihm zu helfen. Alle nahmen eine Schaufel und begannen Erde in den Brunnen zu schaufeln. Der Esel erkannte was los war und weinte zunächst fürchterlich. Dann, zu aller Überraschung beruhigte er sich.
Ein paar Schaufeln später sah der Bauer schließlich in den Brunnen. Er war erstaunt über das was er sah. Mit jeder Schaufel voll Erde die seinen Rücken traf, tat der Esel etwas erstaunliches. Er schüttelte es ab und machte einen Schritt nach oben.
Als die Nachbarn des Bauern weiter Erde auf den Rücken des Tieres schaufelten, schüttelte er es ab und machte einen Schritt nach oben. Ziemlich bald waren alle erstaunt, als der Esel über den Rand des Brunnen trat und glücklich davon trabte.
Moral:
Das Leben schaufelt Schmutz auf dich, alle Arten von Schmutz. Der Trick um da gut rauszukommen ist, es abzuschütteln und einen Schritt nach oben zu machen. Jedes unserer Mühen ist ein Sprungbrett. Wir können aus den tiefsten Brunnen rauskommen, indem wir nicht stoppen und nicht aufgeben! Schüttelt es ab und macht einen Schritt nach oben.

Ein mächtiger Samurai beschloss seine spirituelle Bildung zu vertiefen.
So machte er sich auf, einen buddhistischen Mönch zu suchen, der als Einsiedler hoch in den Bergen lebte.
Als er ihn gefunden hatte, forderte er: „Lehre mich, was Himmel und Hölle sind!“
Der alte Mönch sah langsam zu dem Samurai auf, der mächtig über ihm stand, und musterte ihn von Kopf bis Fuß.
„Dich lehren?“ kicherte er. „Du musst sehr dumm sein, wenn du denkst, ich könnte dich etwas lehren. Schau dich an, du bist unrasiert, du stinkst, außerdem ist dein Schwert ganz verrostet!“
Der Samurai geriet in große Wut. Sein Gesicht wurde rot vor Zorn. Er zog sein Schwert, um dem lächerlichen aufgeblasenen Zwerg von Mönch, der da vor ihm saß, seinen unverschämten Kopf abzuschlagen.
„Das“, sagte der Mönch ruhig, „ist die Hölle!“
Der Samurai ließ sein Schwert fallen. Erst überkam ihn Reue, dann tiefe Zuneigung zu dem alten Mann. Dass dieser Mensch sein Leben riskiert hatte, um einem völlig Fremden etwas zu lehren, erfüllte sein Herz mit Liebe und Mitgefühl. Tränen stiegen in seine Augen.
„Und das“, sagte der Mönch, „ist der Himmel!“
Der übereifrige Dschinn

Einst lebte eine Mutter alleine mit ihren drei Kindern in einem baufälligen Haus am Rande des Tronerwaldes. Tagein, tagaus wusch sie Wäsche, kochte für ihre Kinder, half bei den Hausaufgaben, putzte, hielt den Garen in Ordnung und kümmerte sich um auch alle sonstigen anfallenden Sorgen und Nöte der Familie. Am Vormittag arbeitete sie außerdem noch halbtags im Lebensmittelgeschäft des Ortes.
Viele Jahre hielt sie diesem belastenden Alltag stand, dann wurde es ihr zu viel. Sie begann um Hilfe zu beten. Und ein Gott war ihr gnädig.
Der Gott sprach: „Liebe Frau, wenn du es möchtest, sende ich dir einen Dschinn. Er wurde aus rauchlosem Feuer erschaffen. Dieser Dschinn wird für dich alle anfallenden Arbeiten erledigen. Aber es gibt einen Haken. Du musst den dienstbaren Geist immer beschäftigt halten, ansonsten wird er dir Schaden und großen Kummer zufügen.“
Mit großer Erleichterung entgegnete die Frau: „Oh vielen Dank! Bitte sende mir diesen Dschinn. Es wird kein Problem sein, ihm stets etwas zu Tun zu geben.“
Da erschien im Wohnzimmer in einer Lichtaufwallung vor der betenden Frau ein durchsichtiger Geist und verneigte sich. „Was wünscht Ihr, das ich tue?“
Mit einem Lächeln auf den Lippen bat die Frau den Dschinn, das Haus zu putzen. Sofort machte sich der dienstbare Geist an die Arbeit. Er arbeitete so schnell, dass die Frau ihn nur hin und wieder aufblitzen sah. Nach zehn Minuten funkelte das ganze Haus in frischem Glanz.
Die Frau war höchst zufrieden und befahl: „Nun repariere das Dach. Im oberen Badezimmer regnet es durch.“
Nach kurzer Zeit stand der Dschinn wieder vor der Frau. Das Dach war geflickt und komplett von Moos befreit.
„Nun grabe das Gemüsebeet im Garten um.“
Dafür benötigte der Dschinn nur drei Minuten. Langsam wurde der Frau mulmig zumute. Sie erkannte, dass sie für den Dschinn bald keine Arbeit mehr finden würde und erinnerte sich der Mahnung des Gottes. Erst Angst, dann Panik stiegen in ihr auf. In größter Not fiel ihr der Weise ein, der in den Tiefes des Tronerwaldes lebte. Sie sagte zum Dschinn: „Trage mich zu dem Weisen des Waldes.“
Dort angekommen hörte sich der alte Weise geduldig die eilig hervorgebrachte Notsituation an. Nachdem die Frau geendet hatte, empfahl er: „Bitte den Dschinn, die Eiche vor dem Haus immer wieder hinauf und hinunter zu klettern.“
Die Frau tat wie geheißen und gemeinsam beobachteten sie, wie der Dschinn den riesigen Baum hinauf und hinab stieg. Zu Beginn konnten sie mit ihren Augen kaum folgen, doch nach einer Viertelstunde wurde der Dschinn deutlich langsamer. Als eine weitere halbe Stunde vergangen war, schaffte er den Anstieg nicht mehr.
Zutiefst erschöpft kniete er vor den Füßen der Frau. „Herrin, bitte seid so gütig, mich aus dieser Aufgabe zu entlassen. Ich beuge mich euch nun völlig und verharre still, bis ihr eine neue Anweisung für mich habt. Entgegen meiner ursprünglichen Natur werde ich euch dennoch kein Leid zuzufügen.“
Die Frau stimmte dankbar lächelnd zu und wusste nun für allezeit einen dienstbaren Helfer an ihrer Seite.
Ein Platz am Fenster

Zwei Männer , beide schwer krank , besetzten das gleiche Krankenzimmer. Einem Mann wurde erlaubt, jeden Nachmittag für eine Stunde lang, im Bett zu sitzen, um seine Flüssigkeit aus der Lunge zu bringen. Sein Bett war neben dem einzigen Fenster des Raumes. Der andere Mann musste seine ganze Zeit flach auf dem Rücken verbringen. Die Männer unterhielten sich stundenlang . Sie sprachen von ihren Frauen und Familien, ihren Häusern, ihren Arbeitsplätzen, ihre Beteiligung an dem Militärdienst , wo sie im Urlaub waren .
Jeden Nachmittag , wenn der Mann im Bett am Fenster sitzen konnte , verbrachte er die Zeit damit, seinem Mitbewohner all die Dinge, die außerhalb des Fensters sehen konnte, zu beschreiben.
Der Mann in dem anderen Bett begann, für diese eine Stunde, in welcher seine Welt erweitert wurde, von all den Aktivitäten und Farben der Außenwelt zu leben.
Aus dem Fenster hatte man einen Blick auf einen Park mit einem schönen See . Enten und Schwäne spielten auf dem Wasser, während Kinder ihre Modellboote segeln ließen . Frisch verliebte gingen Arm in Arm inmitten der farbigen Blumen. Man hatte auch einem schönen Blick auf die Skyline der Stadt, welche in der Ferne gesehen werden konnte.
Als der Mann am Fenster all dies beschrieb bis ins kleinste Detail, schloss der Mann, im anderen Bett des Zimmers seine Augen und stellte sich die malerische Szene vor.
An einem warmen Nachmittag, beschrieb der Mann am Fenster, eine vorbei gehende Parade.
Obwohl der andere Mann, die Musik nicht hören konnte, konnte er es sehen. In seinem Geistigen Auge, mit der Beschreibung des anderen Mannes .
Tage und Wochen vergingen .
Eines Morgens, als die Tagesschwester kam , um Wasser für ihre Bäder bringen, stoß sie nur auf den leblosen Körper des Mannes am Fenster, der friedlich in seinem Schlaf gestorben war. Sie war traurig und rief die Krankenhaus Begleiterin, um den Körper aus dem Zimmer zu nehmen.
Sobald es angebracht schien , fragte der andere Mann , ob er neben das Fenster bewegt werden könne. Die Krankenschwester war glücklich, die Verschiebung zu machen, und nachdem sie sich vergewissert hatte, das er komfortabel war, ließ sie ihn allein.
Langsam, schmerzhaft, stützte er sich auf einen Ellenbogen um seinen ersten Blick auf die echte Welt draußen zu werfen.
Er strengte sich langsam drehend an, um neben dem Bett aus dem Fenster zu sehen.
Das Fenster stand vor einer leeren Wand . Der Mann fragte die Schwester , was könnte sein verstorbener Mitbewohner, gezwungen haben, solche wunderbaren Dinge außerhalb dieses Fensters zu beschreiben.
Die Schwester antwortete, dass der Mann blind war und nicht einmal die Wand sehen konnte.
Sie sagte: ” Vielleicht wollte er sie einfach nur ermutigen. “
Die weiße Rose

„Seit ich 12 Jahre alt war, wurde mir jedes Jahr an meinem Geburtstag eine weiße Rose geschickt. Es gab nie eine Karte oder Notiz und auch der Blumenhändler konnte nicht sagen, von wem sie kamen. Nach ein paar Jahren habe ich es schließlich aufgegeben, nach dem Absender zu forschen und mich einfach an dem wunderschönen, jährlichen Geschenk erfreut.
Aber ich habe nie aufgehört, mir in meiner Fantasie auszumalen, wer der Absender sein könnte. Ich verbrachte ein paar meiner schönsten Momente mit den Tagträumen: War es jemand, der von mir fasziniert war, aber zu schüchtern, um sich zu zeigen? Ein Exzentriker, der heimlich Gutes tun möchte? Vielleicht sogar ein Junge, für den ich schwärmte? Es war toll, sich an verregneten Tagen an diesen Gedanken zu wärmen.
Meine Mutter hat oft mit mir zusammen gerätselt, sie hatte sogar richtig Spaß dabei. Sie fragte, ob ich vielleicht jemandem mal einen Gefallen getan habe, der sich jetzt heimlich revanchieren möchte – die Frau von nebenan, der ich den Einkauf reingetragen habe oder der Opa, dem ich im Winter die Post aus dem Briefkasten ins Haus brachte zum Beispiel. Mama hat immer die Fantasie angeregt, denn ihr war es wichtig, dass ich kreativ bin und mich geliebt fühle. Und genauso wichtig war es ihr, dass ich auch anderen dieses Gefühl gebe.
Aber wir mussten auch schwere Zeiten durchstehen. Einen Monat vor meinem Schulabschluss starb mein Vater an einem Schlaganfall. Meine Gefühle schwankten zwischen Trauer, Einsamkeit, Angst und Zorn, weil er nun alle wichtigen Ereignisse in meinem Leben verpassen würde. Ich verlor jedes Interesse an meinem Abschluss und an dem großen Abschlussball, obwohl ich mich so viele Jahre unendlich darauf gefreut hatte.
Meine Mutter wollte nichts davon hören, obwohl sie selbst zutiefst trauerte. Am Tag bevor mein Vater starb, gingen wir shoppen und kauften ein Kleid für den Ball, das zwar unglaublich schön war, aber leider etwas zu groß. Am schlimmen Tag danach habe ich das natürlich komplett vergessen. Aber meine Mutter nicht. Am Tag vor dem Abschlussball lag das Kleid auf meinem Bett – in der richtigen Größe.
Ihr war es immer wichtig, wie ich mich fühlte. Sie lehrte uns, dass es auch in unschönen Situationen immer etwas Liebenswertes gibt. Im Grunde sollten wir uns genau so sehen, wie eine Rose: Lieblich, stark, mit einer magischen und leicht mysteriösen Aura.
Leider starb sie, als ich 22 Jahre alt war, nur wenige Tage nach meiner Hochzeit. Ab diesem Jahr wurde keine weiße Rose mehr geliefert.“
Der Sieg über den Teufel

An einem tiefen, düsteren Wald lag ein kleines Dorf. Immer wieder passierte es, dass Leute in den Wald gingen und nicht zurückkamen. Alle fingen an sich zu fürchten. „Der Wald ist verflucht. Ein Teufel geht dort um“, hieß es. Die Kinder spielten nicht mehr im Wald, und die Männer gingen nur noch gemeinsam zum Holzsuchen.
Eines Tages war von einer 5-köpfigen Familie die kleine Tochter verschwunden. Alle waren sehr betrübt. Wahrscheinlich war sie, obwohl sie es nicht durfte, allein in den Wald zum Spielen gegangen. Alle Männer aus dem Dorf suchten zusammen den Wald ab. Aber sie war nicht zu finden und sie verloren dabei noch einen Mann. Wenige Tage später, als Vater und Sohn der Familie im Wald zum Holzholen waren, zog Nebel auf. Sie verloren sich aus den Augen. Der Vater eilte nach Hause in der Hoffnung, dass auch sein Sohn dort ankommen würde. Aber er wartete vergebens.
Er wollte wieder einen Suchtrupp aufstellen, aber die Leute im Dorf hatten zu viel Angst. So beschloss er alleine nach seinem Sohn zu suchen. Die Frau wollte das natürlich nicht. Sie hatte Angst auch noch ihn zu verlieren. Aber er ließ sich nicht davon abbringen. „Ich fürchte den Teufel nicht. Wenn ich ihn finde wird mein Zorn ihn zerstören. Er hat mir meine einzige Tochter und meinen Ältesten genommen, was habe ich noch groß zu verlieren?“, und zog in den Wald.
Er ging immer tiefer und tiefer in den Wald. Er wusste nicht, wo er suchen sollte. Er wollte schon aufgeben und umkehren, als er plötzlich komische Stöhngeräusche hörte. Er folgte dem Stöhnen und kam an eine Höhle. Ihm war sehr mulmig, aber er fasste seinen ganzen Mut zusammen und begab sich in die Höhle des „Teufels“. Er kam in ein großes Gewölbe wo viele Feuer fackelten. Und dann stand er vor „ihm“. Er war feuerrot sein großer, kräftiger Körper war gepanzert, und er hatte zwei mächtige Hörner. Er war zum Fürchten.
„Ich habe keine Angst vor dir“, und zückte sein Schwert. Der Teufel fing an hämisch zu lachen. Das verärgerte den Vater sehr. „Du hast mir meine Kinder genommen, und dafür wirst du jetzt büssen“ und griff den Teufel an. Aber der viel nur in ein lauthals, brüllendes Gelächter und krümmte sich vor Lachen, statt der Schwerthiebe wegen. Der Vater schlug blindlings vor Hass und Zorn auf den Teufel ein, aber erreichte rein gar nichts. Dann hatte der Teufel genug vom Lachen und wurde ernst. Er griff sich den Vater und nahm ihm das Schwert ab. „Glaubst du wirklich den Teufel besiegen zu können? – Du Narr, ich bin dir weit überlegen, meine Macht ist grenzenlos“, und legte den Vater genauso in Ketten, wie alle anderen Dorfbewohner auch.
Der Vater war sehr froh, dass alle noch am Leben waren. Aber sie waren machtlos dem Teufel ausgeliefert. – Im Dorf wartete man auf die Rückkehr des Vaters. Als er nach Monaten noch nicht zurück war, wurde ihnen klar, dass er wohl nie wieder kommen würde. Die Frau war am Boden zerstört. Alles was ihr geblieben ist, war der 4 jährige Sohn. Die Männer im Dorf machten sich große Vorwürfe. Sie fühlten sich für diesen Verlust mitverantwortlich. Außerdem wollten sie der ständigen Angst ein Ende setzen und beschlossen mit alle Mann den Teufel zu suchen und ihn zu vernichten.
So zogen dieses Mal alle Männer gemeinsam in den Wald. Auch sie fanden die Höhle des Teufels und stellten sich ihm. Sie fürchteten sie nicht, da sie ja in der Überzahl waren. Aber auch hier musste der Teufel nur lachen. Wütend und zornentbrannt stürmte die Meute auf den Teufel. Sie schlugen auf ihn ein, aber für ihn war es wohl wie Kitzeln. Er krümmte sich vor Lachen, was die Männer nur noch mehr erzürnte. Auch hier wurde der Teufel nach einiger Zeit wieder ernst und blies einmal richtig kräftig, dass alle an die Wand geschleudert wurden. Dann packte er sich alle und legte sie in Ketten. „Ihr törichten Menschen, habt ihr noch nicht begriffen, dass man mich nicht bezwingen kann?“
So waren jetzt auch noch alle Männer des Dorfes dem Teufel zum Opfer gefallen. Die Frauen und Kinder im Dorf warteten und warteten, aber die Männer blieben fort. So lebten sie weiter völlig verängstigt. Der mittlerweile 5jährige Sohn konnte das alles nicht verstehen. Immer wieder fragte er, wo die Geschwister, Papa und anderen Männer des Dorfes wären. Doch die Mutter wusste keine Antwort. So beschloss der Sohn nach ihnen zu suchen. Die Mutter wollte das natürlich nicht zulassen, und so schlich er sich heimlich nachts davon. Als die Mutter am nächsten Morgen sein Verschwinden bemerkte, war sie völlig verzweifelt. Sie betete und sagte, „Gott, wieso hast du mir jetzt auch noch meinen letzten Sohn genommen, wofür strafst du mich so hart?“
Der Junge irrte im Wald umher und fragte sich, wie kann ich sie jetzt suchen? Spuren gibt es nach so langer Zeit ja nicht mehr. Aber er erinnerte sich wieder an Gott und die Gebete. Gott wisse alles. Und so sagte er: „Gott ich weiß nicht wo ich suchen soll, bitte nimm meine Hand und führe mich“, und er marschierte weiter, und hatte wirklich das Gefühl geführt zu werden. Und schon nach wenigen Stunden kam er zur Höhle. Er hörte das Stöhnen und machte sich Sorgen. So ging er zielstrebig in die Hölle und gelangte ins große Gewölbe.
Dort stand der kleine Junge nun dem mächtigen Teufel gegenüber. Der Teufel schaute ihn an und war im ersten Moment sprachlos. Der Junge musterte den Teufel von oben bis unten. Er hatte keine Angst und hegte auch keinen Groll gegen den Teufel. Der Teufel brüllte aus tiefster Brust, und schaute dann ganz verdutzt zum Knaben. Der zeigte keine Angst. Im Gegenteil es strömte Mitgefühl aus seinen Blicken. Der Teufel fragt: „Sag mal Junge, hast du keine Angst vor mir?“ „Nein, warum sollte ich?“, kam es zurück. Der Teufel war verwirrt und irritiert. So etwas hat er noch nie zuvor erlebt. „Ja weißt du denn nicht wer ich bin?“, fragte der Teufel und gab gleich darauf die Antwort: „Ich bin der mächtige Teufel, den alle fürchten.“ „Gut, und warum sollte ich dich nun fürchten?“ „Weil ich das Böse, die Sünde eben alles Schlechte bin, das gehasst wird wie die Pest!“, erwiderte der Teufel.
„Oh, das tut mir aber leid. Wenn ich immer so einsam wäre, würde ich wahrscheinlich auch so wütend und zornig werden. Und wenn mich keiner mag und mit mir so spielen möchte, würde ich wohl auch mit Gewalt Spielkameraden suchen wollen. Das ist wirklich nicht gesund. Wut und Hass macht dich krank.“ Diese Worte machten den Teufel richtig wütend. Er fing regelrecht an zu kochen. Er schnappte sich den Jungen und hielt ihn hoch. Der Junge sagte zum Teufel: „Du musst nicht mehr traurig sein, ich liebe dich trotzdem, und ich werde dein Freund, und du wirst auch wieder gesund.“ Der Teufel verstand die Welt nicht mehr und zog den Jungen an sich heran und schaute ihm tief in die Augen.
Das was der Teufel in den Augen des Jungen zu sehen bekam war das Antlitz Gottes. Dieser Wahrheit und reinen Liebe war selbst der Teufel nicht gewachsen und löste sich auf in Wohlgefallen und Rauch. Der Junge verstand das nun nicht. Plötzlich war diese große, starke mächtige Gestalt verschwunden. Aber jetzt hörte er die Gefangenen, die sich die ganze Zeit still verhielten und dem Geschehen zuschauten. Alle waren voller Freude. Als erstes befreite er seinen Vater, Schwester und Bruder, die dann auch halfen alle weiteren Dorfbewohner zu befreien.
Dann machten sie sich gemeinsam auf und kehrten heim in ihr Dorf. Alle Frauen und Kinder freuten sich endlich wieder ihre Männer bzw. Väter zu sehen. Auch die Mutter der Kinder umarmte alle sehr innig, und dankte Gott für dieses große Wunder.
Was ein Heer an Männern in Wochen nicht vermochte, hat ein 5jähriger Junge an einem Tag vollbracht. Hass, Zorn und Wut haben nur dem Teufel gedient. Dadurch wurde der Teufel genährt. Nur die reine, wahre, unschuldige Liebe vermochte es den Teufel zu besiegen.
Quelle: http://www.gespraechemitgott.net/beitrag585.html
Der Weise und der Diamant

Ein weiser Mann wanderte einst in den Wäldern, welche sich über die Täler des auslaufenden Himalaya-Gebirges erstrecken. Hin und wieder verweilte er um formschöne Steine, farbenfrohe Blumen oder zerklüftete Holzstücke zu betrachten.
Am Lauf eines wild verlaufenden Gebirgsbaches entdeckte er einen faustgroßen Stein, der wie ein Kristall glitzerte. Die zahlreichen muldenförmigen Einkerbungen erinnerten den Weisen an die Krater auf der Mondoberfläche. Ohne zu ahnen, was er dort gefunden hatte, steckte er den Stein in seinen Lederrucksack und ging fröhlich pfeifend dem Abend entgegen.
Die Nacht verbrachte der Weise im Schutz einer berghohen Tanne, deren Äste am Boden eine Höhle mit Blick auf den Sternenhimmel formten. Trotz des verborgenen Schlafplatzes stand am nächsten Morgen ein unbekannter Mann neben der Schlafstätte des Weisen. Verschlafen rieb sich der Weise die Augen und fragte den Fremden, welches Anliegen ihn herführe.
„Mich hat ein Traum zu dir geführt“, erklärte sich der Besucher, der sich als Bewohner eines nahen Dorfes zu erkennen gab.
„Ein Traum?“, sagte der Weise.
„Ja! Ich meine sogar, dass Gott mir diesen Traum gesendet hat. Woher hätte ich sonst wissen sollen, dass heute Nacht ein Wanderer unter der großen Tanne schlafen würde, der einen Schatz für mich aufbewahrt?“
Der Weise setzte sich auf und gähnte ausgiebig. „Einen Schatz? Ich? Bei mir findest du nur das, was ich auf dem Leibe trage.“ Er erhob sich und streckte sich, soweit es die herabhängenden Äste der Tanne erlaubten. Da fiel ihm der gestrige Steinfund ein.
„Moment“, bat er und holte aus seinem Rucksack den Kristallstein hervor, „könnte dein Traum diesen Stein meinen?“
Der Dorfbewohner nahm den Stein in die Hand und sackte vor dem Weisen in die Knie. Seine Unterlippe begann zu zittern. „Da … dada … Das ist ein Diamant. Mindestens 1.000 Karat. Der ist ein Vermögen wert.“
„Ich fand ihn gestern am Bach, talabwärts. Wie es scheint, soll er dir gehören. Ich schenke ihn dir. Möge er dir das Glück bringen, was du dir von ihm erhoffst.“
Der Mann starrte ungläubig vom Stein zum Weisen und wieder zurück. Mit einem gehauchten „Habt Dank!“ sprang er auf und lief in sein Dorf zurück.
Dort angekommen versteckte er den Diamanten unter einer Diele in seiner Hütte. Er erzählte niemanden von seinem Schatz, nicht einmal seiner Frau. Zuerst wollte er alles in Ruhe bedenken.
Als sich die Nacht über das Dorf senkte, wollte dem neureichen Dorfbewohner der Schlaf nicht ereilen. Ein bestimmter Gedanke rumorte in seinem Kopf. Immer wieder wälzte er sich von Seite zu Seite. Seine Frau nörgelte, dass er doch endlich mal Ruhe geben möge.
Schließlich fasste der Mann einen Entschluss. Er erhob sich aus dem Bett und eilte im Schein des Vollmondes zur großen Tanne. Zu seiner großen Freude fand er den weisen Mann noch darunter an. Er weckte ihn, fiel auf die Knie und sprach: „Verehrter Fremder. Ich bitte euch, lasst mich euer Schüler sein. Lehrt mich, mit solcher Gelassenheit einen Diamanten weggeben zu können.“
Die Schuld und ihr Zorn

Einst fragte Zen-Schüler Callum seinen Meister: Wie schaffe ich es, mich nicht mehr über den Egoismus meiner Mitmenschen zu ärgern?
Der Zen-Meister antwortete: „Stell dir vor, du gehst am frühen Morgen durch einen sonnigen Park. Du spürst einen zarten Wind im Gesicht, ansonsten ist alles ruhig. Dein Blick wird von hellgrün leuchtenden Trauerweiden angezogen, deren Zweige sanft die Oberfläche eines Teiches voller Seerosen streicheln. Ein zartblauer Eisvogel gleitet über das Wasser, landet auf der Bank vor dir und stimmt sein zauberhaftes Lied an. Völlig versunken lauschst du dem Gesang des winzigen Stimmwunders. Plötzlich wirst du grob an der Schulter gerempelt.
Du starrst auf den breitschultrigen Unhold, während der Schmerz in deine Schulter schießt. Der Vogel entflieht, Ärger flutet deinen Geist. Wie kann dieser Idiot …“
Lächelnd schaut der Zen-Meister seinen Schüler an, der verständnisvoll nickt.
Der Meister fuhr fort: „Doch dann schaust du den Übeltäter ins Gesicht und erkennst, dass seine Augen völlig weiß sind. Du durchschaust: Ich zürne einem Blinden …“
Das Nicken des Schülers endet abrupt.
„… und dein Zorn verschwindet. Dein Schmerz tritt in den Hintergrund, Mitleid über den Blinden kommt auf. Zudem scheint er sich auch weh getan zu haben. Du hörst seine Entschuldigung und winkst ab: Kein Problem, ist doch nichts passiert, ich hätte besser aufpassen sollen. Sie können doch nichts dafür…“
Der Zen-Meister beugt sich zu seinem Schüler hinab. „Wenn du erkennst, dass der Mensch blind ist, Callum, vergibst du ihm seine Schuld. Das ist der Trick, du musst dir bei einem Ärgernis sagen, dass der Mensch blind ist. Oder taub, je nachdem. Dann nimmst du den Vorfall die Schuld und kannst wesentlich leichter deinen Geist in Ruhe halten. Denn fast nie wird dir ein Mensch absichtlich Leid zufügen, er hat nur seinen eigenen Vorteil im Gewahrsein. Die bitteren Früchte seiner Tat übersieht er einfach.“
Quelle: Yoga-Welten.de
Der wahre Wert

Ich habe mich seit Monaten nicht mehr richtig gefreut. Früher beglückten mich gute Bücher, meine zwei Kinder, Kinofilme, Skatrunden, das Fotografieren … Warum das alles seinen Reiz für mich verliert? Das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich habe einen Verdacht …
Ok, es läuft nicht alles optimal in meinem Leben, das ist offenkundig. Letzte Woche bin ich 43 geworden und ich finde seit gut einem Jahr trotz mancherlei Bemühungen keine Anstellung. Ich fürchte mittlerweile, meine Frau und meine Freunde halten mich für wertlos. Nur meine Kinder zeigen weiter Interesse, aber das lässt auch schon nach. Ich bin nicht mehr so lustig wie früher, meinten sie neulich.
Meine Entscheidung vor drei Jahren war mit einem gewissen Risiko verbunden, doch bin ich deshalb für niemand mehr etwas wert? Nur weil ich einmal gescheitert bin?
In den Streitigkeiten mit meiner Frau frage ich mich immer öfter: Sollten wir uns besser trennen? Wie konnte es soweit kommen?
Ich hatte mit Ende 30 meine Festanstellung als Art Director in einer Werbeagentur aufgegeben, um selbst produzierte Poster zu verkaufen. Meine Idee, Weisheitssprüche alter Philosophen mit Aussagen moderner Youtuber zu verbinden und das Ganze mit ebenso zweigeteilten Bildern zu hinterlegen, war der Knaller. Die Verkäufe über eBay hoben mich innerhalb von zwei Monaten in den Rang eines Powersellers. Das hatte mich zum Schritt in die Selbständigkeit ermutigt.
Im ersten halben Jahr verdiente ich so viel Geld wie in zwei Jahren in der Agentur. Wir saßen sogar samstags bis 23 Uhr und haben die Poster versendet.
Doch dann kamen die Nachahmer und die Preise für die Poster sanken bei eBay unter unseren Einkaufspreis. Die Konkurrenten hatten die Frechheit, meine Bilder fast identisch zu klonen, jedenfalls war die dahinterliegende Idee gleich. Dennoch hatte ich bei zwei Prozessen vor Gericht verloren. Für mehr Anwaltsbeschäftigungsmaßnahmen hatte mein Geld nicht mehr gereicht. Irgendwann war es so weit, dass ich die Seite von eBay nicht mehr aufrufen konnte, ohne dass sich mein Brustkorb zusammenzog. Würde wieder ein neuer Konkurrent die Preise kaputt machen?
Mittlerweile bewerbe ich mich seit anderthalb Jahren in Firmen und Agenturen, um dort wieder als Angestellter kreativ tätig sein zu können. Doch ohne Beziehungen scheine ich keine Chance in meinem Alter zu haben. Das gibt zwar keiner der Arbeitgeber direkt zu, aber mein vom Arbeitsamt bezahlter Coach hat mir offenbart, dass in meinem Bereich die Bewerber mit einem Alter von über 35 ungesehen von der Sekretärin ausgemustert werden. Nur über Beziehungen sei da etwas möglich. Daran arbeite ich jetzt, aber alle wissen von meinem Scheitern mit den Postern. Das schwebt wie eine dunkle Wolke über mir. Von selbst macht mich jedenfalls keiner auf freie Stellen in seiner Firma aufmerksam.
Nicht, dass jetzt ein Missverständnis aufkommt. Die Jobprobleme und die Streitigkeiten mit meiner Frau werfen mich nicht zu Boden. Ich sage mir immer: Es wird schon weitergehen, irgendwann öffnet sich eine Tür. Ich lasse den Kopf nicht hängen. Nebenher gestalte ich das Theatermagazin unserer Stadt und entwerfe für Firmen vor Ort Visitenkarten und Geschäftspapiere. In der nächsten Woche habe ich sogar meine erste Vernissage mit meinen Postern. Zwar nur eine kleine Galerie, mehr als zwei Absätze war die Ankündigung in der heimischen Zeitung nicht lang, aber immerhin mit Foto und in der Samstag-Ausgabe.
Dennoch lache ich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts mehr zu lachen. Leiste nicht genug, um lachen zu dürfen. Alles um mich herum raunt mir zu: Du hast es nicht verdient, ausgelassen zu sein!
Meine Frau musste bei der Arbeit aufstocken, damit unsere kleine Familie mit zwei Kindern das Haus nicht verkaufen muss. Sie macht ihre Arbeit gern, das ist nicht das Problem. Aber auf einmal fängt sie an, alles Mögliche an mir störend zu finden. Mal ist der Fernseher zu laut, mal gebe ich bei anderen Peinlichkeiten von mir, mal sollte ich mich mehr mit Politik beschäftigen, mal das Bad sauberer hinterlassen. Alles für sich genommen nachvollziehbar, aber in der Gesamtbetrachtung erscheint es mir, als ob sie in mir nur noch einen Flickenteppich aus Schwächen sieht.
Sie leugnet das, nein – ich soll mich mal nicht so haben, ich bin wohl nicht kritikfähig, ich igle mich in meiner Künstlerwelt ein. Sie hätte mit ihrer besten Freundin gesprochen und auch die habe gestanden, das Kauen mit offenem Mund würde sie bei einem Mann schrecklich nerven. Natürlich schätze sie mich noch. Natürlich …
Aber warum haben wir uns seit vier Wochen nicht mehr geküsst? Warum bewegt sich das Stimmungsbarometer nur noch zwischen neutral bis irgendwas stört mich?
Ich denke, das Problem mit meiner Frau wird sich mit einer neuen Anstellung erledigt haben. Doch auch meine Freunde legen keinen Wert mehr auf meine Gesellschaft. Jeder geht nur seiner Arbeit nach, abends noch ein wenig in Familie und dann ab vor die Glotze. Heute treffen? Bin zu müde – vielleicht in zwei Wochen am Freitag? Aber ich weiß, dass er gestern mit den Arbeitskollegen zum Sundowner in der City war. Und das will mein bester Freund sein. Was ist das für ein bester Freund, mit dem man sich nur einmal im Monat auf ein paar Bier trifft, obwohl man weniger als eine Viertelstunde auseinanderwohnt?
Ich werde immer unsicherer. Ja, das trifft es. Ich bin mir meiner selbst und auch der Wertschätzung aller anderen unsicher.
Ich frage mich: Muss ich vielleicht in meinem Alter darauf verzichten, so richtig gemocht zu werden? Ist das normal und darum einfach zu akzeptieren, dass alle neben dem Job lieber ihre Ruhe haben wollen? Oder bin ich es, der einfach nicht nett genug, nicht interessiert genug, nicht erfolgreich genug ist, sodass andere gerne mit mir zusammen sind? Kann ich daran überhaupt etwas ändern? Oder erlebe ich gerade einfach, dass ich alt werde? Geht sowas damit einher?
Monika ruft an. Mit ihr tausche ich mich aus. Sie erzählt von einem älteren Mann, der in einem Schrebergarten wohne. Sie wisse, dass er ab und an von Menschen Besuch erhält, die seinen Rat suchen. Er sei so etwas wie ein Weiser. Sie nennt mir die Adresse.
Die Kinder sind bei Freunden und kommen erst zurück, wenn meine Frau zuhause ist. Ich breche umgehend auf.
Der Alte ist ganz schön schwer in diesem baumüberfluteten Gartenlabyrinth zu finden. Eine halbe Stunde bin ich umhergeirrt, bevor mir endlich jemand weiterhelfen konnte. Jetzt stehe ich vor der kleinen Hütte des Alten. Ich bewundere das Vordach, welches aus dünnen Baumstämmen künstlerisch zusammengesetzt ist. Wirklich ansprechend. Überall stehen Schalen mit Kräutern, Gartenfiguren und Kerzenbehältnisse herum. Der Alte mag es gemütlich und er hat ein Händchen fürs Dekorieren. Ich klopfe an.
Manchmal bin ich ganz schön leichtgläubig. Vor einer Stunde klopfte ich an die Tür des Alten und jetzt stehe ich auf dem Flohmarkt in der Winzergasse und versuche, ein einziges Bild zu verkaufen. Eine Bleistiftzeichnung von einer alten Wassermühle, eine Wiese davor. Ein Wanderer scheint gerade bei der Mühle anzukommen. Es gefällt mir. Nur rechts unten prangt ein störender Fettfleck.
Der Alte hatte sich meine Klage angehört und mir statt einer Antwort diese Zeichnung in die Hand gedrückt. Zuerst hatte er ein Blatt Papier darüber gehalten, in dessen Mitte ein Rechteck ausgeschnitten war. So konnte man nur jeweils einen Teil des Bildes sehen. Wir stellten fest, dass der jeweilige Ausschnitt den Eindruck machte, als hätte der Maler undeutlich gezeichnet. Manchmal fehlte ein Strich, ein anderer schien falsch gesetzt. Doch als er das Papier wegzog und das Bild sich als Ganzes zeigte, wirkte es stimmig und ich bekam sofort Lust, mal wieder die Alpen aufzusuchen.
Ich verstand, worauf der Alte hinauswollte. Er bestätigte mir dies mit den Worten: „Deine Frau und auch du selbst müsst lernen, das gesamte Bild zu betrachten. Und da seid ihr wunderschön.“ Wenn da nicht der Fettfleck wäre, ergänzte ich in Gedanken.
Mehr wollte der Alte nicht sagen, aber er stellte mir eine Aufgabe: Ich solle doch gleich mal versuchen, die Zeichnung für mindestens 100.- Euro auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Danach solle ich wieder zu ihm kommen.
Nachdem ich drei Stunden erfolglos auf dem Flohmarkt ausgeharrt habe, brechen alle um mich herum ihre Zelte ab. Die Mittagszeit ist vorbei und damit endet der Flohmarkt. Wie aus dem Nichts taucht da noch ein junger Mann mit Rasterlocken – Typ Philosophiestudent – vor meinem Stand auf und zeigt Interesse am Bild. Musternd nimmt er es in die Hand, ich setze mein Pokerface auf. In mir drinnen bin ich gespannt. Würde ich die Zeichnung doch noch loswerden? Hätte ich dann eine Aufgabe bestanden?
„Für fünf Euro würde ich das Papierchen mitnehmen.“
Frustriert gebe ich meinen Stand auf und bringe dem Alten das Bild zurück.
„Was sollte mir dieser Versuch zeigen?“, frage ich. „Wollt Ihr mir sagen, dass ich mittlerweile auch nichts mehr wert bin, genau wie das Bild? Obwohl ich in der Gesamtbetrachtung noch ganz nett anzuschauen bin?“
Statt einer Antwort schickte mich der Alte erneut los. Diesmal in die Nobel-Galerie in der Fußgängerzone. Ich sollte dort einen Schätzwert für das Bild einholen, es aber diesmal auf keinen Fall verkaufen.
Jetzt stehe ich vor dem riesigen Schaufenster der Kunsthandlung. Die Preise der ausgestellten Bilder beginnen im fünfstelligen Bereich. Ich blicke zweifelnd auf meine Bleistiftzeichnung. Wenn der Fettfleck nicht wäre … der Maler – wer auch immer es war – konnte durchaus zeichnen. Mir gefiel das Bild immer mehr, aber hier würde ich mich lächerlich machen. Da war ich mir sicher.
Dennoch … der Alte hat was. Er strahlt etwas aus, das ich bisher noch nicht kannte. Schwer zu beschreiben. Wenn er mich anschaut, fühle ich mich wohl. Geborgen. Und ich bin neugierig, was er mit diesem Bild im Schilde führt. Darum spiele ich weiter mit. Entschlossen drücke ich die robuste Glastür auf.
Mit so einer Reaktion habe ich nicht gerechnet. Der Verkäufer schaute auf meine Frage, was denn dieses Bild wert sei, zunächst skeptisch an mir hinunter. Als er aber die Zeichnung in Händen hält, holte er sofort eine Lupe hervor. Seine Hände zittern leicht. Er murmelt den Namen eines Künstlers, von dem ich noch nie etwa vernommen hatte. Dann zieht er einen Laptop hervor und geht ins Internet. Er blickt zu mir hoch: „Hiernach gehört das Bild“ – er nennt den Namen des Alten, den ich aufgesucht hatte.
Ich nicke – ja, der alte Herr bat mich, das Bild bei Ihnen schätzen zu lassen.
Dann geleitet mich der Verkäufer nach hinten und serviert eine Tasse Kaffee. Sein Tonfall ist einen Hauch zuuuu freundlich. Ob ich kurz Zeit hätte, er müsse nur eben den Inhaber anrufen.
Ich habe. Die anderen Kunden im Laden scheinen den Verkäufer nicht mehr zu interessieren.
Nach einer Viertelstunde war er zurück und offenbarte mir, dass die Galerie bereit sei, 60.000 Euro für das Bild zu zahlen. Er deutete meine starre Verblüffung wohl fehl, denn er ergänzte hektisch: „Ich weiß, bei einer Auktion könnte das Bild deutlich mehr erzielen, aber die Galerie würde mir dieses Risiko abnehmen und würde schließlich sofort bezahlen.“
„Aber der Fettfleck?“
Der Verkäufer lacht auf: „Sein Fingerabdruck, das Markenzeichen des Künstlers. Es ist ein Wachsabdruck seines Daumens, da findet sich wahrscheinlich sogar seine DNA. Ohne den wäre das Bild viel weniger wert. Sammler zahlen das 10-fache für Bilder dieses Künstlers, welche den Daumenabdruck tragen.“
Verdattert stammele ich, dass ich das Angebot an den Besitzer überbringen werde. Ich frage noch nach einer Schutzhülle für das Bild, ich mochte es nicht mehr einfach so in den England-Bildband schieben, wie ich es auf dem Herweg getan hatte.
Nachdenklich radele ich zurück zur Hütte im Schrebergarten und trete nach kurzem Klopfen ein. Ich betrachte den Alten, wie er mich lächelnd von der Küchenbank aus ansieht. Warum lebt er hier in dieser winzigen Hütte? Ich frage spontan nach, doch er geht gar nicht auf meine Frage ein. Stattdessen sagt er: „Den wahren Wert des Bildes hat nur der Fachmann erkannt. Du gehst durch dein Leben und erwartest, dass jeder Mensch deinen wahren Wert erkennt. Das haben die meisten Menschen aber längst verlernt. Oder sie haben gar nicht mehr die Zeit, dich so gut kennenzulernen.“
Ich denke über seine Worte nach. Er ergänzt: „Nimm den Daumenabdruck auf dem Bild. Wenn Menschen diesen scheinbaren Fettfleck sehen, verblasst für die meisten der gesamte Rest des Kunstwerkes. Bei dir könnte dein geschäftlicher Misserfolg dieser vermeintliche Fettfleck sein. Dabei kann aus dem Scheitern eines Menschen etwas ganz Wertvolles erwachsen.“
Ich habe eine Idee: „Also muss ich die anderen zu Fachleuten von mir machen, wenn ich Wertschätzung erwarte? Nach dem Motto: Tue Gutes und spreche darüber? Selbstmarketing?“
Der Alte blickt zu Boden, scheinbar seine nackten Zehen betrachtend. „Ich würde woanders ansetzen.“
„Und wo?“
Der Alte blickt hoch und legt seine runzelige Hand auf meine Schulter. Er sagt: „Die wichtigste Person, die du von dir überzeugen musst, bist du selbst. Wenn du dich selbst wertschätzt, wirst du dies auch von anderen erfahren. Andersherum kannst du die anderen vielleicht kurzfristig blenden. Jedoch niemanden, der dir nahesteht.“
Auf dem Nachhauseweg schiebe ich das Fahrrad. Der Alte hat mir frische Hoffnung gegeben. In meinem Rucksack lagert das sicher verpackte Bild mit dem Daumenabdruck. In drei Monat möchte der Alte die Zeichnung zurückhaben und dann will er hören, wie es mir bis dahin ergangen ist. Ich bin selbst neugierig. Hoffnungsvoll neugierig.
Von Peter Bödeker. Die Geschichte erschien zuerst in der Guten-Morgen-Gazette auf blueprints.de.
Der König und der Tod

“König Yayati ist hundert Jahre alt und liegt im Sterben.
Der Tod kommt und Yayati sagt: ‘Kannst du statt meiner nicht einen meiner Söhne mitnehmen, denn ich habe noch gar nicht gelebt. Ich war so mit Regieren beschäftigt, dass ich darüber vergessen habe, dass ich eines Tages meinen Körper verlassen muss.
Der Tod sagte: “Gut, frag deine Kinder.”
Aber seine Kinder wollten nicht sterben, bis auf den jüngsten Sohn. Er war erst sechzehn Jahre alt und der Tod sagte zu ihm: “Warum Du? Du bist noch so jung und ahnungslos.”
Der Junge erwiderte: “Wenn mein Vater nicht einmal in 100 Jahren zu leben vermochte, wie kann ich hoffen zu leben? Es muss eine andere Möglichkeit geben, zu leben. Mithilfe des Lebens lässt sich das Leben offenbar nicht führen, also werde ich es mithilfe des Todes versuchen.”
Der Sohn starb und Yayati lebte weitere 100 Jahre.
Als die Zeit um war und der Tod wieder an seine Tür klopfte und fragte, ob er noch einmal einen Sohn mitnehmen solle, sagte Yayati: “Nein, ich habe nicht so früh mit dir gerechnet, aber jetzt habe ich begriffen, dass selbst 1000 Jahre nichts bringen. Es liegt an meinem Denken und hat nichts mit der Zeit zu tun.
Ich bin wieder darauf reingefallen.
Mein Verstand ist immer nur mit der Zukunft beschäftigt und deshalb habe ich das Leben verpasst.
Denn das Leben findet in der Gegenwart statt.”
Osho, Zitat – Auszug aus Das Thomas-Evangelium
Die erstaunlichen Meister

Ein Schüler prahlt mit seinem Meister dem Schüler eines anderen Meisters vor.
Er behauptet, dass sein Lehrer zu allen möglichen magischen Handlungen in der Lage ist, wie mit einem Pinsel in die Luft zu schreiben und die Figuren auf einem Stück Papier Hunderte von Metern entfernt erscheinen zu lassen.
„… und was kann DEIN Meister?“ fragt er den anderen.
„Mein Meister kann auch erstaunliche Leistungen vollbringen“, antwortet der andere Schüler.
„Wenn er müde ist, schläft er. Wenn er hungrig ist, isst er.“
Der König mit den 4 Frauen

Es war einmal ein reicher König, der hatte 4 Frauen:
Er liebte die 4. Frau am meisten, schmückte sie mit wertvollen Roben und verwöhnte sie mit den erlesensten Delikatessen. Er gab ihr immer nur das Beste.
Aber liebte auch seine 3. Frau sehr und prahlte mit ihr aufgrund ihrer Schönheit vor den angrenzenden Königreichen. Allerdings befürchtete er immer auch, dass sie ihn eines Tages wegen eines anderen verlassen würde.
Er liebte auch seine 2. Frau. Sie war seine Vertraute, immer freundlich, rücksichtsvoll und geduldig mit ihm. Wann immer der König sich mit einem Problem konfrontiert sah, konnte er darauf vertrauen, dass sie ihm durch die schwierigen Zeiten half.
Die 1. Frau des Königs war eine sehr loyale Partnerin und hatte großen Anteil an der Erhaltung seines Vermögens und seines Königreichs. Er jedoch erwiderte die tiefe Liebe seiner 1. Frau nicht, ja er nahm kaum Notiz von ihr.
Eines Tages wurde der König schwer krank, und es wurde ihm bewusst, dass seine Zeit knapp bemessen war. Er dachte an sein luxuriöses Leben und überlegte: Jetzt habe ich 4 Frauen, aber wenn ich sterbe, werde ich ganz allein sein.
Daher fragte er die 4. Frau: Dich habe ich am meisten geliebt, habe dich mit den feinsten Gewändern ausgestattet und dir die beste Pflege angedeihen lassen. Nun, da ich sterbe, wirst du mir folgen und mir Gesellschaft leisten? Ich denke nicht daran! , entgegnete sie ihm und ging weg ohne irgend ein weiteres Wort. Ihre Antwort machte den König sehr traurig.
Dann fragte er traurig seine 3. Frau: Ich habe dich mein Leben lang geliebt. Nun, da ich sterbe, wirst du mir folgen und mir Gesellschaft leisten? Nein! rief die 3. Frau aus. Das Leben ist zu schön! Wenn du stirbst, werde ich wieder heiraten! Sein Herz verkrampfte, so dass es fast erstarrte.
Schließlich fragte er die 2. Frau: Ich habe mich immer an dich gewandt, wenn ich Hilfe brauchte und du warst immer für mich da. Wenn ich sterbe, wirst du mir folgen und mir Gesellschaft leisten? Tut mir leid, diesmal kann ich dir nicht behilflich sein, antwortete die 2. Frau. Ich kann dich höchstens bis zu deinem Grab begleiten! Ihre Antwort kam wie ein Donnerschlag, und der König war am Boden zerstört.
Da vernahm er eine Stimme: Ich werde mit dir gehen und dich begleiten, wo auch immer du hingehst. Der König blickte auf, und da war seine 1. Frau. Sie war glanzlos und ausgehungert. Zutiefst betrübt sagte der König. „Ach, hätte ich mich doch um dich viel besser gekümmert, als ich noch dazu die Gelegenheit hatte!“
In Wahrheit haben wir alle diese 4 Frauen in unserem Leben!
Unsere 4. Frau ist unser Körper. Egal wie viel Zeit und Mühe wir darauf verschwenden um ihn zu verschönern; er wird uns verlassen, wenn wir sterben.
Unsere 3. Frau ist unser Besitz, unser Status und Reichtum. Wenn wir sterben, geht er auf andere über. Unsere 2. Frau sind unsere Familie und unsere Freunde. Egal wie sehr sie für uns da waren, der weiteste Weg, den sie mit uns gehen können, ist der bis zum Grab.
Und unsere 1. Frau ist unsere Seele, oft vernachlässigt während der Jagd nach Reichtum, Macht und Vergnügungen. Die Seele ist jedoch die einzige, die uns folgt und begleitet, wohin wir auch gehen.
Der vertrauensvolle Berater

Einst lebte ein reicher Maharadscha im indischen Bundesstaat Goa. An seiner Seite fand sich stets der Berater Mantu. Nie sah man den Maharadscha ohne seinen Ratgeber. Dieser besaß nämlich eine besondere Eigenschaft: Er bewertete alle Geschehnisse positiv. Mit solch einem Menschen umgibt sich jeder gern. Auch dem Maharadscha ging es da nicht anders. Zungen bei Hof munkelten, dass der Maharadscha , vor die Wahl gestellt, ob er sich lieber von seiner Frau oder von Mantu trennen würde, mit seiner Antwort gezögert hätte.
Doch eines Tages – bei einer Jagd – sollte sich ein Keil des Zorns zwischen den Maharadscha und den allzu optimistischen Mantu schieben.
Der Morgen der Jagd begann hoffnungsvoll. Die Sonnenstrahlen wurden von durchziehenden Wolken gedämpft, so dass die Hitze nicht überhandnahm. Ansonsten verschliefen die großen Tiere den Vormittag im Schatten. So aber würde sie aktiv umherstreifen.
Der Maharadscha war voller Vorfreude auf das kommende Jagdglück. So erklärte sich auch, dass er beim Anblick des stattlichen Gaurs die Sehne seines Bogens in seiner Aufregung nicht richtig spannte. Der Pfeil verhedderte sich beim Abschuss und das Ende des Pfeiles riss dadurch ein Glied seines rechten Zeigefingers ab. Der Arzt der Jagdgesellschaft konnte das fehlende Fingerteil nicht mehr annähen, er musste sich auf das Versorgen der Wunde beschränken. Der rechte Zeigefinger des Maharadscha würde für immer verkrüppelt bleiben.
Mantu eilte zum Maharadscha und wollte ihn trösten: „Oh Herr, seid nicht betrübt. Es wird sicherlich einen guten Grund haben, dass ihr einen Teil eures Fingers verloren habt. Wartet nur ab, bald werdet ihr erkennen, wozu euch dieser Schicksalsschlag dient.“
Mit diesen vermeintlich tröstenden Worten hätte sich Mantu wohl besser etwas Zeit gelassen. Der Maharadscha geriet in seinem Schmerz über diese Sätze derart in Zorn, dass er seinen doch so geschätzten Berater ins Gefängnis werfen ließ. „Vielleicht findet ihr zwischen dem Stroh und den Flöhen den Sinn meines Verlustes“, rief er Mantu hinterher, als dieser von den Soldaten abgeführt wurde.
Das Unglück konnte den Maharadscha nicht lange von der Jagd fernhalten. Schon in der Woche darauf zog er wieder in den Wald. Doch wollte sich diesmal kein großes Wild zeigen. So befahl er seinen Begleitern zurückzubleiben, damit die Tiere nicht durch übermäßigen Lärm frühzeitig gewarnt wären.
So kam es, dass sich der Maharadscha weit von seiner Wache entfernte. Er drang immer tiefer in das Unterholz und musste sich irgendwann eingestehen, sich verlaufen zu haben. Als er gerade zu einem lauten Hilferuf ansetzen wollte, wurde er von hinten ohnmächtig geschlagen.
Nachdem er wieder zu sich gekommen war, fand er sich auf einem Opferstein gefesselt. Um ihn herum tanzten Wilde im Kreis und sangen kreischende Opfergesänge. Es war tiefe Nacht und das Feuer der Fackeln warf dunkle Schatten in die geschminkten Gesichter der Wilden.
Als ein Stammesangehöriger mit einer den gesamten Oberkörper bedeckenden Maske auf den Maharadscha zutrat, konnte dieser nur auf dessen riesiges Messer starren. Der Maskenmann trug dieses hocherhoben vor sich her.
So würde er also dahinscheiden – als Gottesopfer eines wilden Eingeborenenstammes.
Doch das Schicksal hatte anderes mit ihm vor. Als der Maskenmann den Verband um den Zeigefinger des Maharadscha erblickte, verlangte er wütend nach Ruhe und rief einen Namen. Aus dem Kreis der bis eben Tanzenden löste sich ein junger Mann und eilte mit gebeugten Kopf zum Maskenmann.
„Tarin, wie konnte dir entgehen, dass dieser Mensch verkrüppelt ist. Wenn ich unserem Gott dieses Opfer gebracht hätte, wäre großes Unglück über unseren Stamm gekommen. Geh und bringe den Mann dorthin zurück, wo ihr ihn gefunden habt. Du wirst mir für einen Ersatz verantwortlich sein.“
Der Maharadscha konnte sein Glück kaum fassen. Der gescholtene Tarin zog ihm eine Maske über den Kopf und warf ihn gefesselt auf den Rücken eines Pferdes. Nach einstündigem Ritt schob Tarin den Maharadscha achtlos vom Pferd, hieb dessen Stricke durch und galoppierte den dunklen Weg zurück. Der Maharadscha dankte allen Göttern, zu denen er je ein Gebet gesprochen hatte.
Am nächsten Tag fand der Maharadscha zurück in den Palast. Seine erste Amtshandlung bestand darin, Mantu aus dem Gefängnis kommen zu lassen. Der Maharadscha entschuldigte sich vielmals bei seinem Berater und versprach, in Zukunft mehr Vertrauen in seine Worte zu haben.
Doch der Maharadscha konnte sich nicht davon abhalten, Mantu einen kleinen Seitenhieb zu verpassen. Er fragte: „Sag mir, geschätzter Mantu, findest du auch einen Grund, warum dein Gefängnisaufenthalt etwas Gutes nach sich ziehen wird? Euer Gesicht ist voller Flohstiche, die kannst du wohl nicht als angenehmen Lohn ansehen.“
„Oh verehrter Maharadscha“, hob Mantu an, „das liegt für mich auf der Hand. Wenn ich auf der letzten Jagd bei euch gewesen wäre, hätten wir uns wahrscheinlich zusammen verirrt. Und dann hätten die Wilden mich statt eurer den Göttern zum Opfer gebracht.“